Nicht lieferbar
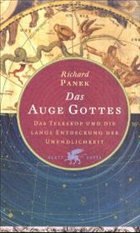
Das Auge Gottes
Das Teleskop und die lange Entdeckung der Unendlichkeit
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Vom Hand- bis zum Hubble-Teleskop 1996 ist es nur ein kosmischer Wimpernschlag, aber in diesem Augenblick befreit sich die Menschheit von Mythen und Märchen. Der Mensch hat sich ein göttliches Instrument gebaut, mit dem er die Sterne und, ohne es zu ahnen, sich selbst erforscht. Er erkennt sich selbst als genauen Beobachter, modernen Forscher, abenteuerlichen Revolutionär und gedemütigten Prometheus. Augenblicklich ist er sich seiner Winzigkeit, seiner unaufhebbaren Nichtigkeit bewußt. Ohne es zu wollen, entthront sich der Mensch durch seine Erfindung. Er ist nicht mehr die Krone, sondern...
Vom Hand- bis zum Hubble-Teleskop 1996 ist es nur ein kosmischer Wimpernschlag, aber in diesem Augenblick befreit sich die Menschheit von Mythen und Märchen. Der Mensch hat sich ein göttliches Instrument gebaut, mit dem er die Sterne und, ohne es zu ahnen, sich selbst erforscht. Er erkennt sich selbst als genauen Beobachter, modernen Forscher, abenteuerlichen Revolutionär und gedemütigten Prometheus. Augenblicklich ist er sich seiner Winzigkeit, seiner unaufhebbaren Nichtigkeit bewußt. Ohne es zu wollen, entthront sich der Mensch durch seine Erfindung. Er ist nicht mehr die Krone, sondern höchstens noch ein Staubkörnchen der Schöpfung. Er entdeckt seine Anfänge und die Anfänge von allem, und er weiß bislang nur, daß er allein im Weltraum ist. Und doch, je tiefer wir heute in diese schiere Unendlichkeit blicken, und je mehr wir wissen, desto geheimnisvoller, desto magischer und unheimlicher wird das Weltall und seine Geschichte, die hier so pointiert wie noch nie erzählt wird.



