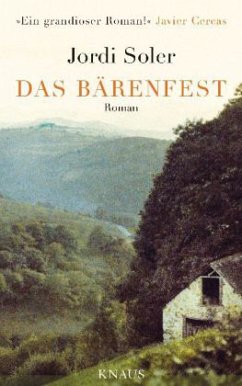Wozu der Mensch fähig ist ein Stück Literatur, das unter die Haut geht
Oriol, Franco-Gegner und republikanischer Kämpfer, ist bei der Flucht über die Pyrenäen im Schneesturm umgekommen. So weiß es die Familienüberlieferung. Fast siebzig Jahre später jedoch kommt sein Großneffe mit Hilfe eines Ziegenhirten und einer Waldfrau einer unglaublichen Geschichte auf die Spur. Sie erzählt davon, was aus einem Menschen werden kann, der alles verloren hat. Jodi Solers Roman über die menschlichen Abgründe in einer archaisch anmutenden Welt ist ein erzählerisches Meisterstück.
Was machen Menschen, die alles verloren haben, Heimat, Familie, Überzeugungen? Im Lauf des Jahres 1939 stoßen in den Pyrenäen aus entgegengesetzten Richtungen kommend zahllose Menschen aufeinander, denen eben dies widerfahren ist. Während von der spanischen Seite aus Bürgerkriegsflüchtlinge versuchen, sich nach Frankreich zu retten, fliehen aus der Gegenrichtung immer häufiger Menschen vor den Nazis. Viele von ihnen verlieren elend ihr Leben. Auch Oriol. In seiner Familie wird er seither wie ein Heiliger verehrt. Bis einem Großneffen ein Gerücht zugetragen wird. Nach abenteuerlichen Recherchen steht er schließlich vor dem Mann, der angeblich seit siebzig Jahren tot ist. Und der damals in aussichtsloser Lage alle Prägungen der Zivilisation abgestreift hat.
Oriol, Franco-Gegner und republikanischer Kämpfer, ist bei der Flucht über die Pyrenäen im Schneesturm umgekommen. So weiß es die Familienüberlieferung. Fast siebzig Jahre später jedoch kommt sein Großneffe mit Hilfe eines Ziegenhirten und einer Waldfrau einer unglaublichen Geschichte auf die Spur. Sie erzählt davon, was aus einem Menschen werden kann, der alles verloren hat. Jodi Solers Roman über die menschlichen Abgründe in einer archaisch anmutenden Welt ist ein erzählerisches Meisterstück.
Was machen Menschen, die alles verloren haben, Heimat, Familie, Überzeugungen? Im Lauf des Jahres 1939 stoßen in den Pyrenäen aus entgegengesetzten Richtungen kommend zahllose Menschen aufeinander, denen eben dies widerfahren ist. Während von der spanischen Seite aus Bürgerkriegsflüchtlinge versuchen, sich nach Frankreich zu retten, fliehen aus der Gegenrichtung immer häufiger Menschen vor den Nazis. Viele von ihnen verlieren elend ihr Leben. Auch Oriol. In seiner Familie wird er seither wie ein Heiliger verehrt. Bis einem Großneffen ein Gerücht zugetragen wird. Nach abenteuerlichen Recherchen steht er schließlich vor dem Mann, der angeblich seit siebzig Jahren tot ist. Und der damals in aussichtsloser Lage alle Prägungen der Zivilisation abgestreift hat.

Allein ohne Google Earth: Jordi Solers "Bärenfest"
Was wäre aus den republikanischen Soldaten geworden, hätten sie auf der Flucht vor den Franco-Truppen im Schnee der Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien Google Earth auf dem Handy gehabt? Und was bedeutet es für unsere Weltwahrnehmung, wenn nicht mehr Kriegsfronten und politische Systeme den Verlauf der grünen Grenze zwischen zwei Ländern markieren, sondern nur umschaltende Mobilfunknetzbetreiber im überall identischen Kapitalismus?
Dergleichen Fragen wälzt der Erzähler von Jordi Solers Roman "Das Bärenfest" im Kopf, als er unversehens aus der Gegenwart des Informationszeitalters in die Abgründe seiner eigenen Familiengeschichte gestoßen wird. Und damit in eine schmerzliche Initiationsreise durch die Kargheit des südfranzösischen Hochgebirges und zugleich die Vergangenheit des spanischen Bürgerkriegs. Sind auch zahlreiche Augenzeugen noch am Leben, wirken die nur ein paar Jahrzehnte zurückliegenden Ereignisse wie ein fernes Universum, wo Spuren im Dunkel der Geschichtswehen verschwinden, Fakten sich in Spekulation verwandeln und dabei die Grenzen zum Imaginären überschreiten. Während heute fast jeder Schritt digital dokumentiert bleibt.
Für den Autor scheint die Entdeckungsreise seines Helden auch eine Suche nach der eigenen Herkunft zu spiegeln: Den Ich-Erzähler verbindet viel mit dem 1963 in Veracruz geborenen Mexikaner Soler. Beide entstammen der zweiten Generation einer republikanischen Familie aus Katalonien, die am Ende des Bürgerkriegs aus Spanien floh und in Mexiko eine neue Heimat fand. Aus der Sicht der Romanfigur allerdings blieb schattenhaft eine Figur in der alten Heimat zurück: Onkel Oriol, von der Familie wie eine Ikone ihrer verlorenen Vorkriegs-Möglichkeiten im Gedächtnis behalten.
Einst ein hochtalentierter Pianist mit winkender Weltkarriere, floh er als Soldat der republikanischen Armee in den letzten Kriegstagen verletzt über einen Pyrenäenpass ins französische Exil, nicht ohne einen schwerverwundeten Kameraden mitzuschleifen und ihm dadurch das Leben zu retten. Während der aber letztlich aus der winterlichen Gebirgshölle fand, verloren sich Oriols Spuren im Schnee der Grenzlandschaft. Nur sein Bruder Arcadi verbreitet im mexikanischen Exil noch immer die Legende, Oriol sei entkommen und in Argentinien zum Starpianisten avanciert.
Dergleichen Familienmythen zerbrechen für den Erzähler, als er, Autor eines Sachbuchs über den Bürgerkrieg, in dem Oriols Schicksal zur Sprache kommt, plötzlich mit einer abweichenden Version der Ereignisse konfrontiert wird. Und zwar in Gestalt des greisen Riesen Novembre, eines Berghirten aus den Pyrenäen, der am Ende des Krieges uneigennützig zahllose republikanische Flüchtlinge vor dem Erfrierungstod rettete. Darunter, wie wir nun erfahren, auch Oriol. Unter mehr als urzeitlichen Bedingungen musste ihm in Novembres Schäferhütte das vom Wundbrand zerfressene Bein amputiert werden. Der gutmütige Hüne und der kleine einbeinige Soldat - bald ein landläufig bekanntes und beschmunzeltes Paar. Auch bei Novembre aber verliert sich die Spur des Onkels. Nun macht sich der Erzähler daran, sie mit Hilfe modernster Recherchemethoden wiederaufzunehmen. Nur geben Internet und digitale Datenbanken nichts her über das, wovon offenbar selbst die Augenzeugen nicht oder nur mit widerwilligem Abscheu reden, so dass allein eigenständige Suche an den Orten des Geschehens weiterhilft - und der Roman damit mehr und mehr in das Genre des Kriminalromans mit Suspense-Momenten gleitet. Stück für Stück zeichnet sich das Psychogramm einer menschlichen und moralischen Degeneration ab, die nichts von der familiären Heiligenlegende übrig, sondern nur einem Verdacht Raum lässt: Oriol sei die ganze Zeit über als finstere Schattenexistenz am Leben gewesen.
Immer wieder verwehrt der Autor seinem Helden den gefürchteten und zugleich ersehnten Blick in den Spiegel seiner eigenen Geschichte mit allem Verzögerungstaktiken. Doch auch nachdem der Suchende durch eine Enthüllung wissend wird, über die dann zahllose Seiten immer nur quälend orakelt wird, darf der Leser genretypisch erst auf der letzten Seite eingeweiht werden. Währenddessen verheddert sich Soler auf seinem metaphorischen Weg durch die Natur und die Geschichte in einem stets wachsendem Erzählgestrüpp.
Immer unklarer wird, wovon hier erzählt wird: von einem pittoresken historischen Kriminalfall? Von der Identitätssuche eines Lateinamerikaners in Europa? Vom Fortleben der Geschichte und ihrer Schatten, die man für längst ausgeleuchtet hielt? Von der Unergründbarkeit des Vergangenen und der menschlichen Seele trotz aller technologischen Fortschritte? Vermutlich ein bisschen von allem zusammen, und genau in dieser unentschlossenen Mischung liegt das Unbefriedigende.
Wenn dann auch der Titel "Das Bärenfest", zur Handlung seltsam unpassend, erst in der letzten Szene seine Erklärung erfährt, die auf einem Volksfest mit uralter Tradition endet, bekommen wir ihn als ziemlich brachiale Metapher für die Gesamtheit des Erzählten gewissermaßen aufgedrängt. "Who was waiting there, who was hunting me?", verkündet schon das Leonard-Cohen-Zitat im Epigraph. Das Fell unter kosmetikglatter Haut, der anachronistische Räuber in uns Zivilisationsmenschen: Symbolbefrachtete Problempelztiere lauern allerorts am Rande des Erzählwegs und machen ihn trotz bemühter Anleihen an den Spannungsbögen von Heftromanen - und trotz der stets stilsicheren Sprache von Peter Kultzens Übersetzung - recht beschwerlich. Als Leser wird man einen naheliegenden Verdacht nicht los: dass der Autor uns einen Bären aufbinden will. So verhallt der zu lang verzögerte und dann befremdlich unwahrscheinliche Paukenschlag am Schluss wirkungslos wie ein Theaterdonner.
FLORIAN BORCHMEYER.
Jordi Soler. "Das Bärenfest". Roman. Aus dem Spanischen von Peter Kultzen. Knaus Verlag, München 2011. 222 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Auf das Tier im Manne stößt Jeannette Villachica in diesem autobiografischen Roman von Jordi Solers, dessen dreiteilige Familienchronik damit abgeschlossen wird. Das Buch führt die Rezensentin über die darin geäußerten Erinnerungen, Hoffnungen und Realitäten hin zu Solers eigener Wahrheit, ist für sie Dokumentation und historischer Roman, Reisereportage und Thriller in einem. Angelegt als Entmystifizierung einer Familienikone im Dunstkreis des Bürgerkriegs, sieht Villachica den Roman vor allem auch als Selbstbefragung des Autors. Etwas gewöhnungsbedürftig erscheinen ihr Solers Neigung zum Moralisieren und Dramatisieren. Atmosphärisch dicht und klug komponiert findet sie ihn aber auch.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH