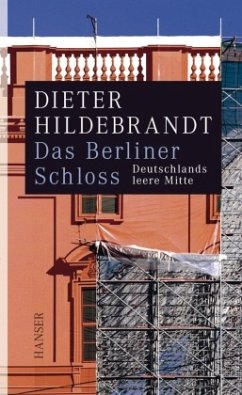Fünf Jahrzehnte konnte niemand das Berliner Schloss leiden. Voltaire, Friedrich der Große und die meisten anderen Schlossbewohner wollten ihm lieber entkommen denn es bewohnen. Dieter Hildebrandt stellt die Frage an uns Zeitgenossen: Warum wollen wir partout zurück in dieses Schloss, das tausend Zimmer, aber keine Seele hatte? Hatten nicht die Berliner schon 1448 ein besseres Gespür für Architektur, als sie den ersten Burgbau durch eine Wasserflut zu verhindern wussten? Dem Hype um die Rekonstruktion in der Mitte Berlins setzt Dieter Hildebrandt einen verblüffenden Rückbau entgegen.

Keine Gnade für den bürgerfeindlichen Klotz der Hohenzollern! Dieter Hildebrandt hat die schönste aller Polemiken gegen den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses geschrieben.
Was für ein wunderbares Buch! Eine Schatzkammer von Anekdoten, Episoden, Histörchen, ein ungehemmt fließender Strom der Gelehrsamkeit, eine Weltgeschichte im Plauderton. Und das Wunderbarste daran: wie dieses Buch, je länger man in ihm liest, ein Eigenleben, einen eigenen Willen entwickelt. Es denkt gar nicht daran, seinem Autor in die Richtung zu folgen, in die er es zwingen will. Stattdessen lässt es sich von seinem Thema bezirzen und bezaubern, so wie es den Leser bezaubert und bezirzt; es taucht mit ihm in die Tiefe seines Gegenstands und findet darin eine Welt. Und der Autor selbst? Auch er kann sich der Faszination, die er doch brechen wollte, nicht völlig entziehen. Er hat seine Feder gespitzt, um zu sticheln, zu verletzen, mit Worten zu töten; am Ende aber ist es fast eine Hommage geworden. Die Handschrift eines Meisters trägt sie allemal.
Dieter Hildebrandt, der Autor bemerkenswerter historisch-biographischer Essays über Beethovens neunte Symphonie oder Schillers kluge Schwester Christophine, hat eine Streitschrift gegen das Berliner Schloss geschrieben. Das ist nicht neu, Polemiken gegen den Wiederaufbau, seine Initiatoren, Lobbyisten und künftigen Nutznießer gibt es viele; aber diese ist die beste. Sie ist die beste, weil sie die schönste ist. Und sie ist die schönste, weil sie, statt immer nur über das Schloss zu reden, das Schloss selbst reden lässt.
Es ist ein Haus voller Geschichten. Eine, die allererste, beispielsweise erzählt davon, wie die Hohenzollernresidenz, als sie noch gar nicht stand, von den Berlinern schon gehasst wurde, wie sie die Fundamente der Zwingburg, die auf Befehl des Kurfürsten Friedrich Eisenzahn in ihrer Stadt emporwuchs, mit Wassermassen aus der Spree wegzuschwemmen versuchten. Eine andere, knapp zweihundert Jahre jüngere, handelt von einem Preußenherrscher, der im Fieberwahn aus seinem eigenen Palast flieht, gejagt von jener "weißen Frau", von der niemand genau weiß, wer sie eigentlich ist - eine verirrte Magd, eine misshandelte Mätresse oder, wie Fontane später mutmaßte, das Hoffräulein Wangeline von Burgsdorff, die einen hohenzollerschen Erbprinzen vergiftet hat und von ihrem schlechten Gewissen durch die Flure getrieben wird.
Eine dritte, ziemlich traurige Geschichte schließlich erzählt von einer Prinzessin und ihrem Lieblingsbruder, die sich nach längerer Trennung auf der Hochzeit der Prinzessin wiedersehen: "Beim Näherkommen erkannte ich ihn, obschon mit Mühe: er war erstaunlich viel stärker geworden und kürzer am Hals; auch sein Gesicht war sehr verändert ... Er trug eine stolze Miene und schien auf jedermann herabzublicken." Es ist der in der Küstriner Festungshaft durch seinen Vater gedemütigte, zum Menschenhasser verhärtete Thronfolger Friedrich, aus dem kaum zehn Jahre später "der Große" werden wird - einer von vielen Bewohnern, Insassen, Opfern des Berliner Schlosses.
Das Grundmotiv, auf das Hildebrandt die gesamte Suite seiner Schloss-Episoden stimmt, ist das der Flucht. So gut wie jeder, von dem er erzählt, will weg aus dem "steinernen Labyrinth" mit seinen zuerst mittelalterlich-trutzigen, dann renaissancehaft-verschnörkelten, am Ende hochbarocken Mauern - vom brandenburgischen Kurfürsten Joachim I. Nestor, der im Jahr 1524 vor der astrologisch angekündigten Sintflut auf den Tempelhofer Berg flüchtet, über Voltaire, dem die Gastfreundschaft des großen Friedrich in seinem Zimmerchen über der Spree zur unerträglichen Last wird, bis zum "Kartätschenprinzen" Wilhelm, dem späteren deutschen Kaiser, der sich im Revolutionsjahr 1848 im Zug nach Hamburg davonmacht, um nicht dem Zorn der Berliner Bürger anheimzufallen, die er hatte zusammenschießen lassen wollen. Das Hohenzollernschloss blieb ihm verleidet: Noch als regierender Monarch nahm Wilhelm die Wachparade lieber von seinem Arbeitszimmer im Palais Unter den Linden ab.
Worum es dem Autor bei diesen Schilderungen geht, ist klar: Er will seinen Lesern das Schloss gründlich madig machen. Wenn schon die Hohenzollern selbst den Kasten nicht mochten, um wie viel weniger braucht da die Berliner Republik ein solches "Denkmal der Nutzlosigkeit", eine "monumentale Gelegenheits-Absteige", die sich nur ein paar von "Nostal-Gier" zerfressene "Repliken-Republikaner" sehnlichst zurückwünschen? Ja, das müsste man sich tatsächlich fragen - wenn es sich so verhielte, wie der immer wieder hinter dem Erzähler Hildebrandt hervordrängende Schlosshasser Hildebrandt uns weismachen will.
Aber so ganz funktioniert der Indizienbeweis nicht, den der eine mit Hilfe des anderen anstrengt. Denn erstens kann auch dieses tief parteiische Buch nicht unterschlagen, dass es durchaus Preußenkönige gab, denen das Schloss am Herzen lag - etwa Friedrich Wilhelm II., der dessen Räume durch Erdmannsdorff verschönern, oder sein Enkel Friedrich Wilhelm IV., der dem Bau die Stülerkuppel aufsetzen ließ. Und zweitens steigert der Erzähler selbst mit jedem genaueren Blick, den er ins Innere des Gebäudes wirft, das Interesse des Lesers an dem nur scheinbar monolithischen, machtgetränkten, bürgerfeindlichen Klotz in der Mitte Berlins.
Die Privaträume des "Soldatenkönigs" etwa, die sein Thronerbe Friedrich der Große nach dem Tod des Vaters versiegeln ließ, bis sie von Würmern und Motten zerfressen waren: Gibt es ein sprechenderes Symbol der zerstörten, in Hass verkehrten Sohnesliebe? Oder der Weiße Saal, in dem drei Generationen von Hohenzollern ihre Architekturphantasien auslebten: Wo wäre ein besserer preußisch-deutscher Erinnerungsort? Das alles, versteht sich, wird es nie mehr geben, auch nicht im zukünftigen Humboldt-Forum auf dem Schlossplatz, aber es ist so lehrreich wie herzerquickend, bei Hildebrandt noch einmal davon zu lesen, auch und gerade dort, wo er über das, was hinter den Schlüterfassaden geschieht, nur den Kopf schütteln kann.
Es trifft sich, dass die Reihe der Hohenzollernherrscher mit Wilhelm II. abbricht, dem unreifsten und pathologischsten Vertreter der Dynastie. Für Hildebrandt, der die verbalen Entgleisungen Wilhelms mit schaudernder Akribie auflistet, ist das ein willkommener Anlass, vor der Wiederaufrichtung der "Topographie eines früheren Gewaltwahns" zu warnen, welcher "die Räume mit dem Wahnwitz seiner Worte kontaminierte". Wenn Kaiserworte zu Stein werden könnten wie die Zaubersprüche in "Harry Potter", dann müsste man sich tatsächlich vor dem neuen Berliner Schloss alias Humboldtforum fürchten. Aber in den Schlosskellern, die unter der Betondecke des einstigen Paradeplatzes der DDR zum Vorschein kamen, fand man nur die eingeritzten Spuren von Heizern und Mägden. Man muss also nicht jedes Wort dieses Buches, das fern von den Brachen und Bausünden Berlins an den sonnigen Hängen des Odenwalds entstanden ist, auf die Goldwaage legen. Ein Lesegenuss ist es trotzdem.
ANDREAS KILB.
Dieter Hildebrandt: "Das Berliner Schloss". Deutschlands leere Mitte.
Hanser Verlag, München 2011. 272 S., Abb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Das Buch kommt spät, zu spät, bedauert Jens Bisky, um die Berliner Schlossbauenthusiasten zu bekehren. Doch bekehren möchte Dieter Hildebrandt wohl auch nicht, nur ein bisschen Schloss-Geschichte erzählen, stets pointiert und leidenschaftlich, wie Bisky erfreut feststellt, und dokumentieren, was die Bewohner, die Friedrichs und Wilhelms, im Gemäuer so empfanden. Bisky hält das schlicht für so intelligent, dass er Regalmeter Anti-Schloss-Literatur dafür drangibt. Bedauerlich erscheint ihm allerdings nicht nur das späte Erscheinen des klugen Bandes, sondern auch Hildebrandts Siebenmeilenstiefelei bis zu Wilhelm II., ohne viel kunsthistorisches oder ästhetisches Aufhebens. Geradezu verstörend findet er, wie der Autor schließlich die Sprengung des Baus rechtfertigt. Den unterstellten Größenwahn, der sich angeblich in den Schlossmauern manifestierte, nimmt Bisky ihm nicht ab. Als Streitschrift gegen grassierende Preußen-Nostalgie taugt ihm Hildebrandts lichte Schrift aber vorzüglich.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Dieter Hildebrandt hat die schönste aller Polemiken gegen den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses geschrieben. Was für ein wunderbares Buch!" Andreas Kilb, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.09.11
"Hildebrandts Buch liefert einen pointierten Blick auf die Geschichte eines streitbaren Denkmals, indem es aufzeigt, wessen Geistes Kind Bauherr und Bewohner des Schlosses stets waren." Jürgen Tietz, Neue Zürcher Zeitung, 08.10.11
"Dieter Hildbrandt polemisiert so intelligent wie unterhaltsam gegen die Sehnsucht nach dem Berliner Schloss" Jens Bisky, Süddeutsche Zeitung, 04.01.12
"Hildebrandts Buch liefert einen pointierten Blick auf die Geschichte eines streitbaren Denkmals, indem es aufzeigt, wessen Geistes Kind Bauherr und Bewohner des Schlosses stets waren." Jürgen Tietz, Neue Zürcher Zeitung, 08.10.11
"Dieter Hildbrandt polemisiert so intelligent wie unterhaltsam gegen die Sehnsucht nach dem Berliner Schloss" Jens Bisky, Süddeutsche Zeitung, 04.01.12