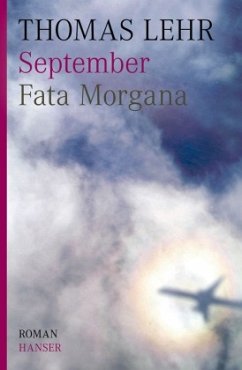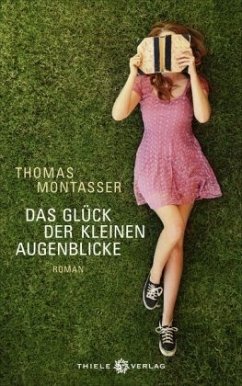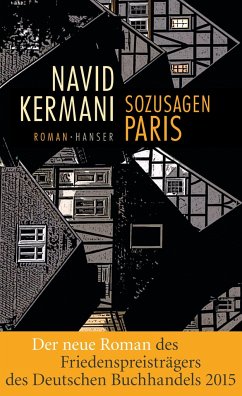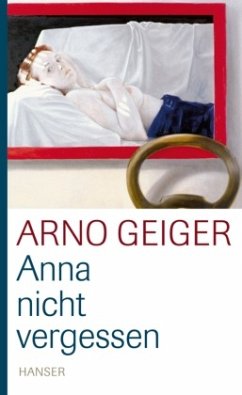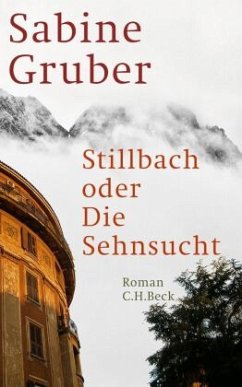"Eine lesenswerte Höllenfahrt durch die Abgründe der Alltagswelt." Alexander Cammann, Die taz, 22.09.07 "So ein Buch gehört sich eigentlich nicht. Ein Roman über den Literaturbetrieb, der sich und seine Leser in den lakonischen Irrwitz treibt. Wer es liest, hat über Stunden hin zu lachen." Ursula März, Die Zeit, 20.09.07 "Eine furiose Egomanie. Auf komischste Art doppelt gemoppelt ist das Buch des jungen österreichischen Schriftstellers. Es handelt von den Leiden eines Schreibenden, von der Sehnsucht nach öffentlicher Wahrnehmung und den Zumutzungen durch ihre Protagonisten, ohne deshalb eine Literaturbetriebssatire zu sein. Das könnte banal sein, wäre da nicht Glavinics virtuoser Umgang mit dem Komischen." Paul Jandl, Neue Zürcher Zeitung,
12.09.07 "Ein überaus kluges, komisches, interessantes, kurz: lesenswertes Buch." Richard Kämmerlings, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 01.09.07 "Ein kurzweiliger, komischer und durchgeknallter Roman, der tiefe Einblicke in die komplexe Psyche eines jungen, aber nicht unerfahrenen Schriftstellers verschafft." Gerrit Bartels, Der Tagesspiegel, 23.08.07 "Humor ist schwer. Selbstironie vielleicht noch schwerer. Glavinic beherrscht dieses Metier." Daniela Strigl, Der Standard, 18.08.07 "Thomas Glavinic gelingt das seltene Kunststück, eine halbfiktive Figur auf der Grundlage seines eigenen, eher durchschnittlichen Lebens zum Hanswurst zu machen und dabei stilistisch auf hohem Niveau zu operieren." Kolja Mensing, Deutschlandradio, 21.08.07 "Die Kunst dieses Romans besteht darin, dass all das so flüssig, leicht und komisch bis zum bitteren Ende heruntererzählt ist. Und dazu komplett selbstironisch. Denn der Teufel steckt vor allem in Glavinic selbst." Gerrit Bartels, Der Tagesspiegel, 23.08.07 "Natürlich macht die Lektüre auch deshalb so großen Spaß, weil man sich an den Neurosen, Überspanntheiten, Lächerlichkeiten und Liebeswürdigkeiten des Helden so ungefiltert erfreut"'Das bin doch ich' - das soll das lustigste deutschsprachige Buch dieses Herbstes sein, wie es nun werbemäßig von vielen Dächern pfeift? Stimmt genau. Der in Wien lebende Schriftsteller Thomas Glavinic, 35, hat ein gerissenes, wüstes und nicht die Bohne banales Buch geschrieben über das Saufen, das Fressen, das Reden - und die Sehnsucht nach dem Deutschen Buchpreis." Wolfgang Höbel, Der Spiegel, 41/2007 "Vielleicht ist das Erfolgsgeheimnis von Glavinic' Buch vor allem eine Frage des Taktes: Denn obwohl sein Material authentisch ist, geht er damit bei aller narzisstischen Extremität so delikat um, dass sich der Leser nie wie im Reality-TV fühlt. ... 'Das bin doch ich' ist ein psychologisch enorm gescheites Buch, das den eigenen Nabel beschaut, ohne darüber den Kopf zu verlieren." Ijoma Mangold, Süddeutsche Zeitung, 09.10.07 "Es ist große komische Kunst, wie der Autor Glavinic die Ängste, Wünsche und Neurosen seines Roman-Doppelgängers in einem pointierten, nie überdrehten Parlando-Ton notiert, als feile er an einer ans Amt für Schriftstellererfolg gerichteten Beschwerdeschrift. Es ist hinreißend, wie waghalsig hier einer mit Fiktion und Exhibitionismus jongliert. Das schönste, seltsame Wunder dieses Buchs aber bewirkt, dass einem der paranoide, glücklich verzweifelte Held nicht bloß die Lachtränen in die Augenwinkel treibt, nein: Er wächst einem wirklich ans Herz." Wolfgang Höbel, Der Spiegel, 41/2007 "Thomas Glavinic ist sicherlich eine der Entdeckungen des Jahres. ... Sein Roman 'Das bin doch ich' war der mit Abstand ungewöhnlichste Schmöker auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis." Brigitte Helbling, Welt am Sonntag, 11.11.07