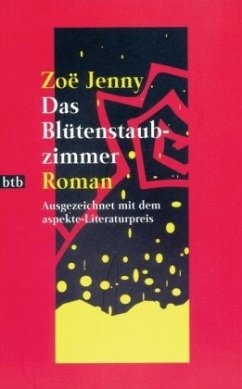Die Scheidungswaise Jo sieht ihre Mutter nach zwölf Jahren zum ersten Mal wieder. Doch die Annäherung erweist sich als schwierig, ihre Hoffnung auf Freundschaft und Nähe wird bitter enttäuscht. Desillusioniert von den Lebenslügen der Erwachsenen vollzieht Jo die Trennung. Wie eine Schlangenhaut wirft sie ihre Kindheit ab.

Böse Blicke: Zoë Jennys Roman "Das Blütenstaubzimmer"
Als Zoë Jennys Debütroman "Das Blütenstaubzimmer" im Herbst letzten Jahres erschien, überschlugen sich die Kritiken. Dies sei die Abrechnung der Techno-Generation mit den Achtundsechziger-Eltern, hieß es, und immer wieder wurden Vergleiche bemüht: mit Bettina Galvagnis todesdurchwehter Leidensprosa "Melancholia" auf der einen, Alexa Hennig von Langes verunglücktem Partyclip "Relax" auf der anderen Seite. Daß die einzige Gemeinsamkeit der drei Bücher möglicherweise darin bestehen könnte, daß hier junge Autorinnen zu Wort kommen, die sich nicht nur medienwirksam für den Buchmarkt, sondern auch im dekorativen Dreigestirn für Podiumsdiskussionen eignen, ließ man lieber außer acht. Fest stand, daß junge Autorinnen über nichts anderes schreiben als über sich selbst und damit über ihre Generation. Ein Rezensent hätte da auch gerne mal zugegriffen; er verspürte den heftigen Wunsch, eine dieser lebenden Autorinnen "anzufassen, den leichten Babyspeck rund um ihren schönen Bauchnabel zu berühren".
Zoë Jennys "Bütenstaubzimmer" hat wenig zu tun mit dem Lärm um ihre Generation. Die achtzehnjährige Jo erzählt die Geschichte eines Abschieds von den Eltern. Es ist die Geschichte eines leisen Aufbegehrens. Am Anfang steht die Erinnerung an ein Kindheitstrauma, das abendliche Drama des Zubettgehens, ausgefochten zwischen Vater und Tochter in einer immergleichen stummen Szenerie: An ihrem Bett stehend, zeichnet Jos Vater mit der glühenden Zigarette Figuren ins Dunkel, bevor das Kind unter dem rhythmischen Geklapper seiner Schreibmaschine einschläft. Anschließend, wenn er die Wohnung verläßt, um als Nachtfahrer das Geld zu verdienen, das es ihm unter Tags erlaubt, weiterhin Bücher zu drucken, wird auch das Kind wieder erwachen. Mit dem Geräusch der ins Schloß fallenden Tür erstehen dann jene Gespenster auf, die in jeder Kindheit das Dunkel bevölkern, Nachtgesichte, die der ängstlich Zurückgelassenen bis in die frühen Morgenstunden den Schlaf rauben.
Als die Erzählerin ein Wiedersehen mit ihrer Mutter erzwingt, liegen zwölf Jahre der Trennung hinter ihr. Die Suche wird durchbrochen von Reminiszenen, Rückblenden und Traumerzählungen; ein komplexes und verschachteltes Zeitgefüge, in dem sich die Erzählerin verstrickt. Sie kann dem Bann der früheren Erlebnisse, den Enttäuschungen und Verletzungen nicht entkommen. Die Begegnung mit der Mutter stößt Jo endgültig aus dem Nest. Mutter und Tochter bleiben sich fremd, Nähe entsteht selbst dann nicht, als Jo ihre Mutter aus dem Blütenstaubzimmer befreit, in das sich diese nach dem plötzlichen Tod des Lebensgefährten zurückzieht. Sie bräuchte sie nicht, lautet die Zurückweisung der Mutter. Für Jo ist es der Auslöser, endlich eine andere Richtung einzuschlagen.
Diese ersten eigenen Schritte markieren den sprachlichen Bruch innerhalb des Romans. Was zuvor originelle poetische Bilder fand - das "Blütenstaubzimmer" etwa, ein leerer, allein mit dem Staub von Blüten übersäter Ort der Trauer -, kippt jetzt um in flache, allzu konventionelle Bilder des Existentiellen. Pausenlos überwältigt von Ekel und Abscheu vor der Welt, nimmt die Protagonistin den Dreck unter ihrem Fußnagel als "eklige schwarz-weiße Landschaft" wahr; Kate Moss "grinst böse" von einer Plakatwand herunter, die Rolltreppe "spuckt die Menschen aus" in eine "riesige schwarze Wüste", und eine Kirche wird zum "Käfig". In einem solchen künstlich geschwärzten Szenario verlieren selbst die Begegnungen mit Luciano, dem talentlosen Musiker aus dem Dorf, und mit dem verwöhnten Wohlstandsmädchen Rea ihren Reiz. Die eine mündet geradewegs in eine Abtreibung, die andere in den Traum, gemeinsam mit der Freundin in ein fernes, unbekanntes Land zu reisen. "Milwaukee" heißt die Chiffre für diesen imaginären Ort, wo "kein Mensch ist", ein Fluchttraum, längst zum Klischee verkommen: Das Leben ist immer anderswo.
Wenn am Ende die Erzählerin aufbricht und eine weiße "Decke aus Schnee" über alles Vergangene fällt, ist die Enttäuschung auf Seiten des Lesers groß. Was von dem komplexen Erzählgefüge des Anfangs übrigbleibt, ist ein einziger Handlungsstrang, der im eindimensionalen Bild der unberührten Schneeschicht verendet. Zoë Jenny löst das Versprechen des Anfangs nicht ein. Und es gilt abzuwarten, ob sie es in Zukunft wird halten können. JULIA ENCKE
Zoë Jenny: "Das Blütenstaubzimmer". Roman. Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 1997. 139 S., geb., 29,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main