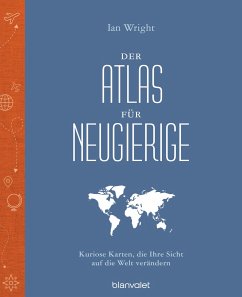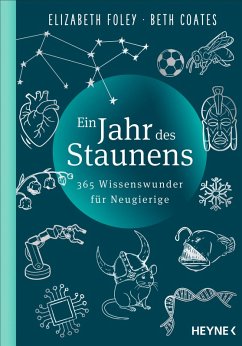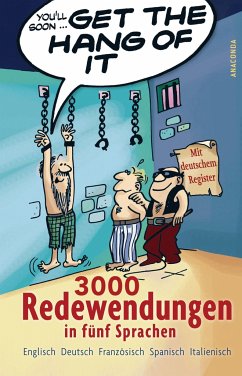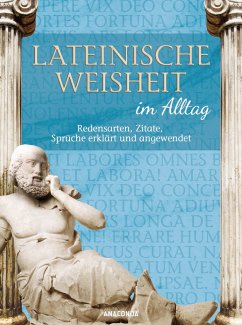Das Buch der Blindenschrift
Schriften, Praxis, Wörterbuch
Versandkostenfrei!
Nachdruck / -produktion noch nicht erschienen
22,00 €
inkl. MwSt.
Jahrhunderte lang hatten Blinde keine Möglichkeit, sich schriftlich auszudrücken oder Bücher und Zeitungen zu lesen. Dies änderte sich im Jahr 1825, als der Franzose Louis Braille die nach ihm benannte Punktschrift erfand. Heute gilt diese weltweit als Standard-Blindenschrift. Auch Sehende stoßen im Alltag immer öfter auf die Punkte, mit deren Hilfe in der Brailleschrift Buchstaben, Zahlen und Satzzeichen dargestellt werden. Und häufig sind sie fasziniert von diesen Punkten, die sie weder mit den Augen noch mit den Händen "erfassen" können. Dieses Buch macht Sehende mit der Blindensch...
Jahrhunderte lang hatten Blinde keine Möglichkeit, sich schriftlich auszudrücken oder Bücher und Zeitungen zu lesen. Dies änderte sich im Jahr 1825, als der Franzose Louis Braille die nach ihm benannte Punktschrift erfand. Heute gilt diese weltweit als Standard-Blindenschrift. Auch Sehende stoßen im Alltag immer öfter auf die Punkte, mit deren Hilfe in der Brailleschrift Buchstaben, Zahlen und Satzzeichen dargestellt werden. Und häufig sind sie fasziniert von diesen Punkten, die sie weder mit den Augen noch mit den Händen "erfassen" können. Dieses Buch macht Sehende mit der Blindenschrift vertraut. Wie setzen sich die Zeichen zusammen? Welche Schriftarten gibt es? Wie kann man Braille schreiben - mit der Hand oder am Computer? Darüber hinaus enthält es ein Wörterbuch der Braille-Punktschrift, in dem Worte und Wendungen, die im Alltag häufig vorkommen, dargestellt werden. Im Anschluss daran können Sehende anhand vieler praktischer Übungen die Brailleschrift selbst erlernen. Inklusive Braille-Alphabet in Reliefform.