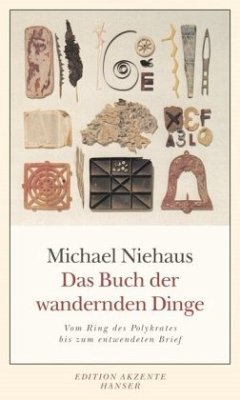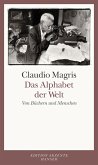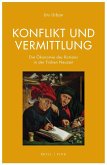Die in ihnen schlummernde Macht offenbaren die Dinge erst, wenn Weggeworfenes zurückkommt: wie der Ring des Polykrates, wenn Verschicktes von einem Dritten versteckt wird; wie "Der entwendete Brief" von E. A. Poe, wenn Verschenktes in den Händen eines Dritten auftaucht; wie das Taschentuch in Shakespeares "Othello". Der Literaturwissenschaftler Michael Niehaus erzählt Geschichten, in denen Dinge von Hand zu Hand gehen. Sein Buch schöpft aus dem reichen Fundus von Literatur, Film und Theater und schildert das rätselhafte erotische oder detektivische Begehren, die Verführungskraft und die Beunruhigung, die wandernden Dingen und ihren Geschichten innewohnen.

Ein Sachbuch im besten Sinn: Michael Niehaus geht in Literatur, Theater und Film den reizvollen Verwicklungen nach, die wandernde Gegenstände unter ihren oft ahnungslosen Besitzern stiften.
Nachdem in den Geistes- und Kulturwissenschaften lange Zeit vom Verschwinden des Realen die Rede war, ist das Pendel mittlerweile längst in die Gegenrichtung ausgeschlagen. Zahllose Bücher handeln von der Macht und Bedeutsamkeit der Dinge, und es gibt wohl kaum ein Artefakt, das nicht als Schlüsselfigur einer kulturhistorischen Studie in Frage käme. Da es endlos viele Dinge gibt, kann es eben auch endlos viele Ding-Monographien geben, und jeder Versuch, der schieren Menge an Zeug eine Gestalt abzugewinnen, steht vor der Herausforderung, eine spezifische Zugangsweise zu entwickeln. Zu den Büchern, denen das in hervorragender Weise gelingt, gehört das kürzlich erschienene "Buch der wandernden Dinge" des Literarturwissenschaftlers Michael Niehaus. Anhand eines beachtlichen Fundus aus Literatur, Theater und Film geht Niehaus den Verwicklungen nach, die daraus entstehen, dass Dinge ihre Besitzer wechseln, vertauscht und vererbt werden können, zu Indizien werden oder einfach abhandenkommen. Neben vertrauten Beispielen wie Edgar Alan Poes "Der entwendete Brief" oder Alfred Hitchcocks "Notorious" bringt Niehaus dabei auch zahlreiche überraschende Funde.
Niehaus' Lektüre all dieser Geschichten von Ringen, Steinen, wandernden Münzen oder Kleidungsstücken zielen weder auf eine Motivgeschichte noch auf eine Symboltheorie des Dings. Vielmehr geht es um die Frage, wie ein Ding seinen Besitzer in Konstellationen versetzen kann, von denen er selbst gar nichts gewusst hat und die sich auch nur bedingt kontrollieren lassen. Die leere Coca-Cola-Flasche, die in Jamie Uys' Film "Die Götter müssen verrückt sein" achtlos aus einem Flugzeug geworfen wird, konnte von den Buschmännern, die sie auflesen, eben nicht erwartet werden, sondern musste ihnen als rätselhafter Vorfall zustoßen. Und wenn Niehaus Shakespeares "Othello" referiert, dann folgt das Geschehen nicht den Begierden und Machenschaften der Darsteller, sondern ordnet sich um die stumme Präsenz des Taschentuchs, das im dritten Akt erscheint, um dann durch verschiedene Hände zu gehen.
Das wandernde Ding, so Niehaus, ist "auf rätselhafte Weise mehr als das, was die Figuren in den Geschichten mit ihm anstellen". Es geht seiner eigenen Wege und kommt mit den Bedeutungen, die man ihm zuschreibt, nicht immer zur Deckung. Der geschärfte Blick für die Struktur solcher Ding-Konstellationen führt Niehaus sicher durch sein weitverzweigtes Labyrinth der Texte und Bilder. Zugleich bewahrt er ihn aber auch vor den beiden Verkürzungen, die das Reden über Dinge häufig bestimmen: dem Anthropomorphismus, der die lakonischen Objekte zu vertraulichen Kameraden macht und überall menschliche Physiognomien erblickt, sowie dem Animismus, der die Dinge mit allerlei Absichten und Willensbekundungen versieht. Beide Formen der Einverleibung verfehlen das Spröde und Teilnahmslose der Dinge, das Paul Valéry einmal als "Nullpunkt der Bedeutung" beschrieben hat und das Niehaus in manchen seiner Lektüren durchscheinen lässt.
Das wandernde Ding, so heißt es am Ende des Buches, sei keine Sache der Theorie. "Wenn wir den Blick starr auf es richten, um es abzuzeichnen, wird es uns umso sicherer entgehen." Zu Recht nähert sich Niehaus seinem Gegenstand deshalb nicht durch Deduktionen und begriffliche Fixierungen, sondern im phänomenologischen Durchgang durch die Geschichten selbst. Das ist der große Reiz dieses Buches. Es ist ein Sachbuch im besten Sinne und unterscheidet sich wohltuend von den zahllosen Erzeugnissen der Sekundärliteratur, bei deren Lektüre man vor allem den stilistischen Absturz im Vergleich zum literarischen Primärtext zur Kenntnis nimmt.
Zugleich handelt es sich keineswegs um ein theoriefreies Buch. Die beim Lesen bereits geahnten Bezüge zu Lacan und Heidegger werden auf den letzten Seiten deutlich markiert, und am Beginn des Textes steht eine Reflexion über die "Sachherrschaft", wie sie sich aus juristischer Perspektive darstellt. Das narrative und strukturorientierte Vorgehen wird dem Buch freilich nicht nur Freunde machen. Die methodische Konsequenz dieses Verfahrens ist die Konzentration auf den Plot. Das reflektierte Nacherzählen erzeugt einen ganz eigenen geschlossenen Textraum, der aber leicht auch allzu homogen wirken kann. In ihm scheint es letztlich ohne Belang, ob eine Geschichte aufgeschrieben, im Theater aufgeführt oder verfilmt worden ist. Auch leistet sich der Autor einige Längen und Wiederholungen.
Umgekehrt vermisst man einige Autoren, die - wie Proust, Flaubert oder Nabokov - für das Thema einschlägig sind. Es wäre jedoch verfehlt, diesem Buch Vollständigkeit abzuverlangen, auf die es gar nicht angelegt ist. Überdies hat der Autor mit seinen Lektüren eine Spur gelegt, die sich in eigenen zukünftigen Lektüren weiterverfolgen lassen. So kann man diesem eigenwilligen Buch nur wünschen, dass es selbst zum wandernden Ding wird und viele Leser erreicht.
PETER GEIMER
Michael Niehaus: "Das Buch der wandernden Dinge". Vom Ring des Polykrates bis zum entwendeten Brief. Carl Hanser Verlag, München 2009. 405 S., br., 21,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
"Variantenreich", aber auch "allzu tiefschürfend": Mit Michael Niehaus hat Rezensent Tobias Haberkorn einen Lacan-Kenner entdeckt, der seine Vorliebe für die psychoanalytische Sprache des Franzosen nicht immer sofort offenlegt. Wie Haberkorn etwas irritiert feststellt, bekommt man in diesem Buch über das Wesen der Dinge, wie sie im westlichen Literatur- und Filmkontext ausgedeutet werden, doch einige Lacansche Begriffe ("Ehre des Vaternamens", "imaginäres Dreieck") trocken und unerklärt vor die Augen gesetzt, so dass Lacan-Laien bei dem ohne Zweifel "sprachlich ausgefeilten" Text doch ihre Mühe haben dürften. Gleichwohl strotzt das Buch für Haberkorn nur so vor kurzweiligen und erkenntnisreichen Passagen, gerade auch wenn sich aus dem unerschöpflichen narrativen Archiv bedient wird. So erfreut sich Haberkorn beispielsweise sehr an der Neubetrachtung von Shakespeares "Othello", in der nun alles vom Einfluss des Taschentuchs her erzählt wird. Unter diesem zweigeteilten Urteil erklärt Haberkorn das Buch zur Geschmackssache.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH