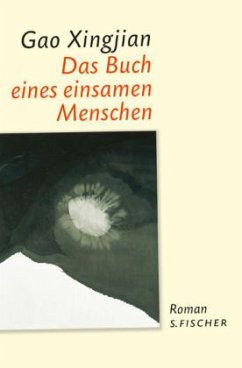Hongkong zur Zeit der chinesischen Kulturrevolution. Durch die leidenschaftliche Liebe zu einer deutschen Jüdin wird der Erzähler zur Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit gezwungen, ein farbenprächtiges Wechselspiel von Erinnerungen und Gegenwärtigem beginnt. Fragen über seine chinesische Identität und die Bewältigung traumatischer Erinnerungen durch politischen Terror sowie die Möglichkeiten literarischen Schreibens, aber auch seine vielen Liebesbeziehungen stehen im Zentrum des Romans. Einstimmungsvolles Buch von zarter melancholischer Stille mit starker Sogkraft.

Die Kulturrevolution als Schule der Beliebigkeit: Gao Xingjians "Buch eines einsamen Menschen"
Nicht an allen Gründen für seine hiesige Nichtbeachtung ist der chinesische Literaturnobelpreisträger Gao Xingjian unbeteiligt. Keine Schuld traf ihn zweifellos an der sperrigen Übersetzung seines Buchs "Der Berg der Seele" vor drei Jahren, die vielen Lesern einen Zugang verschlossen haben dürfte. Genausowenig ist Gao für die Exotismus-Falle haftbar zu machen, in der sein Werk wie viele andere Kunst aus nichtwestlichen Kulturen gefangen ist: Die Anwendung europäischer Avantgarde-Techniken wird ihm als Verrat an seiner Tradition, als Anpassung an den westlichen Markt ausgelegt, während die chinesischen Elemente in seinen Büchern oft unerkannt bleiben, wenn nicht als Unbeholfenheit empfunden werden.
Doch von der Verantwortung für Sätze wie diesen kann man ihn schwerlich freisprechen: "Sie streichelte dich und ließ ihre zarten Hände über deinen Körper wandern, mit der Hingabe, die Frauen zu Eigen ist." Der Satz ist leider kein Ausrutscher, sondern der kitschige Normalfall bei der Schilderung der zahlreichen Liebesabenteuer in Gaos neuem Werk, dem "Buch eines einsamen Menschen". Fast keine der Frauen, mit denen das mit "du" angeredete Alter ego des Autors eine Affäre hat, bekommt ein eigenes, halbwegs differenziertes Profil; die Frauen dienen nur als Projektionsfiguren für die Beschreibung der gleichbleibend melancholischen Gefühlslage des Mannes und, schlimmer noch, für dessen gewissermaßen metaphysische Ambitionen. Denn erst durch die Ekstasen, zu denen ihn eine deutsche Jüdin in einem Hongkonger Hotelzimmer bringt, sieht sich der Du-Erzähler zu dem vorliegenden Buch veranlaßt. Die schöne Blonde redet zwischen den Liebesspielen nämlich immer nur vom Holocaust, während er seiner Vergangenheit in der Kulturrevolution bis dahin lieber aus dem Weg gehen wollte. So vermählt sich der Schwulst mit der Anmaßung, und man kann nur befürchten, daß viele Leser den Roman nach solchen Anfängen etwas ratlos aus der Hand legen werden.
Das wäre sehr schade. Denn im Zentrum des Romans steht eine Schilderung der chinesischen Kulturrevolution, wie es sie bisher noch nicht gegeben hat. Lakonisch und genau, ganz ohne die peinlichen Bemühtheiten der Rahmenhandlung, erzählt Gao, wie sein Held, hinter dem er sich offenkundig selbst verbirgt, nicht nur als Opfer, sondern auch als Täter die düsteren zehn Jahre von 1966 bis 1976 erlebte. Jahreszahlen und andere Daten fehlen indessen ganz, und auch die große Politik wird nur insofern erwähnt, als sie auch den Akteuren damals bekannt war. Im Unterschied zu Solschenyzins "Archipel Gulag" ist der Anspruch dieses Buchs kein unmittelbar historischer oder politischer. Die Frage, die sich Gao stellt, ist, was die Kulturrevolution aus ihm gemacht hat - und die Antwort, die der Leser erhält, ist ein kollektives Psychogramm der chinesischen Gesellschaft. Der Abstand der Jahrzehnte war offenbar notwendig, um die existenziellen Auswirkungen dieser Zeit überhaupt in den Blick bekommen zu können.
Alle äußeren Ereignisse werden aus einer Innenperspektive erzählt. Schon zu Beginn, als es die Führer der Kommunistischen Partei noch selber übernahmen, das von Mao geforderte Feuer gegen die "Schlangengeister und Rinderdämonen" in nächtlichen Kampfsitzungen zu eröffnen, wird dem Helden sein Selbst mit einem Mal zweifelhaft: "In der Tat war ihm überhaupt nicht klar, welcher Klasse er eigentlich angehörte, jedenfalls nicht dem Proletariat, und daher hatte er auch wirklich keinen klaren Standpunkt." Er bemerkt, wie in der sich ausbreitenden Angst alle zum Chamäleon werden; man schreibt eine Wandzeitung und Selbstkritik nach der nächsten und bittet um Einzelgespräche. Dem Held wird klar, daß er eine Maske tragen muß, wenn er überleben will, und er verbrennt alle seine Notizbücher.
In der nächsten Phase spürt er, daß es bei diesen raschen Stromwechseln nicht ausreicht, bloß mitschwimmen zu wollen, und macht sich zum Führer einer neuen Rebellenfraktion. Inzwischen sind die Parteiführer selbst zu Opfern der Kampagnen geworden, und unter den jugendlichen Rotgarden bilden sich immer neue revolutionäre Linien. "Man spielte mit der Revolution", heißt es an einer Stelle: "Es war ein Lotteriespiel, das den Gewinner zum glorreichen Helden, den Verlierer zum abscheulichen Monstrum machte." Der Held wird mit Untersuchungen zur Vergangenheit der Funktionäre beauftragt: Ein Großgrundbesitzer in der Verwandtschaft oder ein Telefongespräch nach Hongkong reichte, um plötzlich zum Feind der Revolution zu werden.
Es gelingt dem Helden, auch die dritte Phase zu überleben, in der Mao den Rotgardisten seine Vollmacht entzieht und an ihrer Stelle Militärkommissionen einsetzt. In ihrem Auftrag bleibt der Protagonist weiter den üblen Elementen mit kapitalistischen Tendenzen auf der Spur und fühlt doch zugleich, wie die Schlinge sich immer enger um den eigenen Hals legt: Eine falsche Betonung beim Rufen der Parolen konnte tödlich sein. Zur Landverschickung meldet er sich freiwillig. Doch auch in die vermeintliche Idylle dringt der Kampf gegen die Konterrevolution vor. Als er die Jäger nahen sieht, flieht der Held zu einem Freund in einem entlegenen Dorf. Er sehnt sich nach einem ganz privaten Glück mit Haus und Familie, doch die Frau, die er heiratet, entdeckt seine Notizen und beschimpft ihn in einem Wahnsinnsanfall als "Feind": So tief ist die Besetzung der Gedanken und Gefühle durch die revolutionäre Abstraktion gedrungen.
Nach der Lektüre ahnt man, daß diese Kulturrevolution das Land und wohl auch die Partei selbst gründlicher entideologisiert haben muß, als dies jeder Regimewechsel vermocht hätte. Mit einem Mal erscheint der Nominalismus, mit dem die Partei ihren Manchesterkapitalismus der Gegenwart als Weg zum Sozialismus verkauft, als ganz natürliche, ja zwangsläufige Konsequenz der Willkür und Beliebigkeit, mit denen Ideen und Ideale in den Jahren des Terrors täglich neu erfunden und gewechselt wurden.
Für den Held des Buchs war die Zeit eine umfassende Kontingenzerfahrung: Nicht nur der Kommunismus, sondern die Welt überhaupt erwies sich ihm als brüchig, und das Leben kommt ihm nur noch wie eine "Pose" vor. Postmoderne Indifferenz verschwistert sich mit daoistischem Gleichmut: "Es ging nur noch darum, ganz sachte diese Lebenshaltung zu bewahren und dich, wenn du dich irgendwo in Einsamkeit auf dich selbst besannst, um das Wunderbare des Augenblicks zu bemühen und im Einklang damit zu sein." Eigentümliche Ironie, daß die Erfahrung der bilderstürmerischen Kulturrevolution am Ende wieder in Lebensweisheiten der ältesten chinesischen Tradition mündet.
Der Autor verzichtet darauf, diese Geschichte trotz ihres unverkennbar autobiographischen Inhalts in der fortlaufenden Kontinuität eines "Ich" zu erzählen. Statt dessen spaltet er seinen Helden in ein "Er", das die Kulturrevolution erlebt, und ein "Du", das in der französischen Emigration lebt. So ist der Eindruck von Affektiertheit, der bisweilen entsteht, paradoxerweise gerade der Preis für eine Ehrlichkeit, die nichts harmonisieren will. Um der erzählerischen Ökonomie willen wäre es wohl besser gewesen, sich auf die Kulturrevolution zu beschränken. Aber dieses großartig aufrichtige Buch ist offenkundig zuerst eine Beichte (im Originaltitel nennt es sich "Bibel"), und eine Beichte will von Ökonomie nichts wissen.
Gao Xingjian: "Das Buch eines einsamen Menschen". Roman. Aus dem Chinesischen übersetzt von Natascha Vittinghoff. S. Fischer, Frankfurt am Main 2004. 478 S., geb., 29,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Die Vermutung unseres Rezensenten, der in Frankreich lebende Autor habe mit seiner chinesischen Vergangenheit abgeschlossen, hat sich nicht bestätigt. Auch in seinem zweiten großen autobiografischen Roman aus dem Jahr 1999, der nun auf Deutsch vorliegt, beschäftigt sich Xingjian mit der Geschichte seiner Heimat, so Ludger Lütkehaus, und was der Autor von den Terrorjahren der Kulturrevolution zu berichten hat, findet er ausgesprochen eindrucksvoll. Leider zerfalle der Roman in zwei Teile, bedauert der Rezensent: einen die erotischen Beziehungen resümierenden Teil, der in Du-Form vorgetragen wird, und einen geschichtlich-politischen Strang als Erzählung in dritter Person. "Die Sprache des Fleisches und der Leidenschaft bleibt hinter der der geschichtlichen und politischen Erfahrung zurück", heißt es in aller Deutlichkeit bei Lüdkehaus. Um so spannender findet er aber den politischen Teil, der sich durch große Ehrlichkeit auszeichne, weil Xingjiang die Ambivalenz der eigenen Rolle in den Jahren der Kulturrevolution, zwischen Anpassung und Widerstand changierend, nicht ausspare. Insofern sei der Roman weder plakativ noch "bloße Gegenproganda".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH