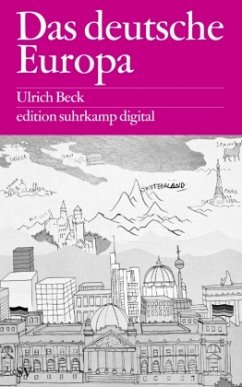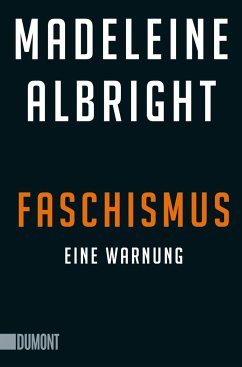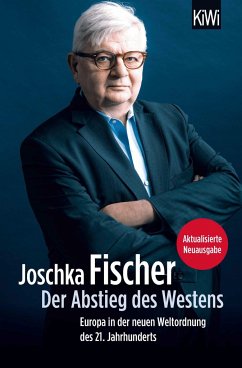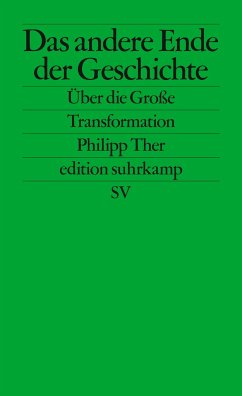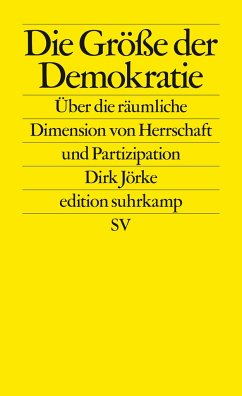Das demokratische Zeitalter
Eine politische Ideengeschichte Europas im 20. Jahrhundert
Übersetzung: Adrian, Michael

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Das demokratische Zeitalter ist die erste umfassende Studie des politischen Denkens in Europa, die den ganzen Kontinent in den Blick nimmt und die Vorgeschichte des heute vieldiskutierten postdemokratischen Status quo liefert, ohne die sich dieser nicht verstehen lässt. Sie setzt 1918 ein und reicht bis zum Zusammenbruch der realsozialistischen Staaten Osteuropas Ende der 1980er Jahre. In einer meisterhaften Mischung aus Geistes- und Kulturgeschichte zeichnet Jan-Werner Müller nach, welche politischen Ideen und Köpfe das Zeitalter der ideologischen Extreme bis 1945 geformt und welche das Sc...
Das demokratische Zeitalter ist die erste umfassende Studie des politischen Denkens in Europa, die den ganzen Kontinent in den Blick nimmt und die Vorgeschichte des heute vieldiskutierten postdemokratischen Status quo liefert, ohne die sich dieser nicht verstehen lässt. Sie setzt 1918 ein und reicht bis zum Zusammenbruch der realsozialistischen Staaten Osteuropas Ende der 1980er Jahre. In einer meisterhaften Mischung aus Geistes- und Kulturgeschichte zeichnet Jan-Werner Müller nach, welche politischen Ideen und Köpfe das Zeitalter der ideologischen Extreme bis 1945 geformt und welche das Schicksal Europas danach maßgeblich bestimmt haben.