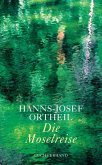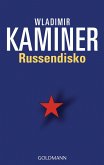Ein junger Iraker gerät unter die Gotteskrieger und flieht nach Deutschland. Ein kluger Abenteuerroman, der mit Spannung zeigt, wie ein kleines Leben von großen Umwälzungen erfaßt wird.
Das Buch erzählt die Geschichte des jungen Kerim, von Beruf Koch, der sich aus dem irakischen Grenzland auf die beschwerliche und gefährliche Reise nach Europa macht. Von früh an der Idee verfallen, sich zu verwandeln, hat er noch andere Gründe für seine Flucht, war er doch unter die Gotteskrieger geraten und mit ihnen durch das Land gezogen, bevor er sich von ihrem Weg der Gewalt lossagte. Kerim, bemüht, in Deutschland ein neues Leben zu beginnen, kann, obwohl er in dem fremden Land auch Zuwendung und sogar seine erste Liebe findet, die Vergangenheit nicht abschütteln, vielmehr scheint diese sich fortwährend auf ihn zuzubewegen.
In diesem Roman geht es nicht um den Islam, sondern um den Extremismus, der viele Erscheinungsformen haben kann, um seine Verführungsmacht und die Folgen. Extremismus entsteht nicht in einem Kopf, sondern unter realen Lebensbedingungen. So ist Kerims Geschichte die eines kleinen, konkreten Lebens inmitten großer Umwälzungen, und sein spirituelles wie auch seine realen Abenteuer sind nicht so außergewöhnlich, wie sie aus europäischer Sicht scheinen mögen. Viele haben sich wie er auf den Weg gemacht, viele sind auch wie er verstrickt worden, wenn schon nicht immer aus nachvollziehbaren Gründen, so zumindest doch auf eine Weise, welche auch die besten Nachrichtenbilder uns nicht zeigen können.
Das Buch erzählt die Geschichte des jungen Kerim, von Beruf Koch, der sich aus dem irakischen Grenzland auf die beschwerliche und gefährliche Reise nach Europa macht. Von früh an der Idee verfallen, sich zu verwandeln, hat er noch andere Gründe für seine Flucht, war er doch unter die Gotteskrieger geraten und mit ihnen durch das Land gezogen, bevor er sich von ihrem Weg der Gewalt lossagte. Kerim, bemüht, in Deutschland ein neues Leben zu beginnen, kann, obwohl er in dem fremden Land auch Zuwendung und sogar seine erste Liebe findet, die Vergangenheit nicht abschütteln, vielmehr scheint diese sich fortwährend auf ihn zuzubewegen.
In diesem Roman geht es nicht um den Islam, sondern um den Extremismus, der viele Erscheinungsformen haben kann, um seine Verführungsmacht und die Folgen. Extremismus entsteht nicht in einem Kopf, sondern unter realen Lebensbedingungen. So ist Kerims Geschichte die eines kleinen, konkreten Lebens inmitten großer Umwälzungen, und sein spirituelles wie auch seine realen Abenteuer sind nicht so außergewöhnlich, wie sie aus europäischer Sicht scheinen mögen. Viele haben sich wie er auf den Weg gemacht, viele sind auch wie er verstrickt worden, wenn schon nicht immer aus nachvollziehbaren Gründen, so zumindest doch auf eine Weise, welche auch die besten Nachrichtenbilder uns nicht zeigen können.

Sherko Fatahs beklemmender Terror-Roman / Von Wolfgang Schneider
Ein getretener Hund krümmt sich und würgt eine menschliche Hand heraus. Dergleichen kommt vor im Straßenleben des Iraks. Dort sind Teile zerfetzter Menschenkörper keine ganz seltene Beute für die Tiere.
Es sind solche Szenen, die sich ins Lesergedächtnis einbrennen bei der Lektüre von Sherko Fatahs deutsch-irakischem Roman "Das dunkle Schiff". Ein fabelhaftes, spannendes Buch, sehr zu Recht ein Kandidat für den Preis der Leipziger Buchmesse. Egal, ob es die Auszeichnung erhält oder nicht - Fatah ist eine Entdeckung. Vor sieben Jahren debütierte er mit dem Roman "Im Grenzland". 1964 in Ost-Berlin geboren, hat er nicht nur durch seinen Vater einen irakischen Migrations-, sondern zudem einen DDR-Hintergrund. Eine Biographie, die einen Schriftsteller formen kann.
Einen dermaßen starken Romananfang voll Schönheit und Schrecken hat man jedenfalls lange nicht gelesen: Ein Sommertag im bergigen Nordirak, eine Landschaft "wie eine geöffnete Hand", Wolken ziehen "wie Luftschiffe durch den tiefblauen Himmel". Lachend und schwatzend sammeln die Landfrauen Kräuter. Der kleine Kerim beobachtet die Szene. Da nähert sich ein Helikopter, landet, Soldaten springen heraus, treiben die Frauen zusammen. Mit den Kräutersammlerinnen steigt der Helikopter wieder auf, der Junge winkt, auch er wäre gerne mitgeflogen: "Und tatsächlich kam die Maschine erneut heran, das Donnern wurde laut und lauter, bis er sich die Ohren zuhielt. Den Kopf im Nacken sah er die Frauen. Da fielen sie, eine nach der anderen stürzte aus der Luke, mit gebreiteten Armen glänzten sie auf im Licht, und wie um sie aufzuhalten, riss an ihren Gewändern der Wind."
Viel später erst ist von diesem Ausflug, den Kerim mit dem Vater unternahm, noch einmal die Rede. Erklärt wird auch dann nichts. Offenbar hatten solche Mordaktionen gegen die kurdische Minderheit eine gewisse Üblichkeit, damals, in den achtziger Jahren, unter Saddam Hussein. Seit Kerims Geburt folgt ein Krieg auf den anderen. Man hat damit und mit der Diktatur zu leben gelernt, laviert sich durch den beschädigten Alltag. Kerims Vater wagt es, einmal aufzumucken. Er betreibt ein kleines Restaurant an einer Straße nach Süden. Als zwei Gäste, Geheimdienstmänner, sich im Gespräch brüsten, wie sie mit den Köpfen ihrer Gegner Fußball spielen, lässt er die Teller mit dem Essen auf den Tisch knallen. Eine Viertelstunde später ist er tot.
So wird Kerim selbst Koch und Gastwirt, betreibt das Restaurant weiter, um die Familie durchzubringen. Bis Jahre später (der Diktator ist schon beseitigt) der Tag kommt, an dem er von den "Gotteskriegern" in die Berge verschleppt wird - eigentlich hatten sie es nur auf sein Auto abgesehen. Kerim übt sich in Mimikry, lernt das Turbanbinden, um schließlich beinahe Gefallen zu finden an dem kargen Leben. Da gibt es einen "Lehrer", der fast unmerklich zur geistigen Autorität für ihn wird. Dieser Mann mit dem "amüsierten Ausdruck im Gesicht" ist ein Charismatiker, eine merkwürdige Mischung von Sanftmut und brutaler Entschlossenheit. Die Gotteskrieger werden durchaus nicht als gewaltverliebte Dumpfköpfe dargestellt. Mag ihre martialische Frömmigkeit auch absurd anmuten; ihre Kritik an den westlichen Lebensformen - bündig formuliert, während amerikanische Bomben einschlagen - wird bisweilen ungemütlich plausibel.
Es ist jedenfalls eine bittere Pointe des Romans, dass ihre Lehren in Kerims Kopf erst während des Exils wirklich aufgehen. Es gelingt ihm, aus der Gruppe zu fliehen, bevor er für einen Selbstmordanschlag bestimmt wird. Auf seiner Reise nach Europa verbringt er Tage der Todesangst als blinder Passagier im dunklen Bauch eines Frachtschiffes, wird entdeckt und auf einer winzigen Insel ausgesetzt. Endlich gelangt er nach Berlin zu seinem Onkel, wo auf die Robinsonade die Behörden-Satire des Asylantrags folgt.
Im Kontrast zur Belanglosigkeit des Berliner Alltagslebens gewinnen die Anschauungen des "Lehrers" nun von Tag zu Tag mehr Überzeugungskraft. Die knapp zweihundert Seiten, die in der deutschen Hauptstadt spielen, beeindrucken durch ihren verfremdeten Blick auf das Vertraute. "Sie leben seit sechzig Jahren in Frieden", meint der Albaner Ervin über die Deutschen, "alles was sie kennen, ist Tourismus". Einmal, als Kerim auf dem Eis eines Berliner Sees einbricht, wird er knapp gerettet von einer Studentin, mit der sich bald ein Liebesverhältnis entwickelt. Doch muss diese bald feststellen, dass der stille, bescheidene, ganz auf sie angewiesene Mann langsam zum unheimlichen Fremdling wird, der eine Innenwelt von düsterem Ernst vor ihr verschließt.
"Das dunkle Schiff" ist ein Abenteuerroman mit ironischem Fundament. Denn Kerim hat gar nicht die Statur eines abenteuerlichen Helden. Normalität wäre wohl eher nach seinem Sinn. Weil er aber unter den Bedingungen der politischen Dauermisere keine Chance hat, zum Herrn seines Lebens zu werden, das vom Zufall gesteuert wird, wirkt er fremd in der eigenen Haut, wie ein Mann ohne Eigenschaften. Eine innere Leere plagt ihn, eine vage Sehnsucht nach Zugehörigkeit, die ihn für die Lehren der Gotteskrieger empfänglich macht.
Das Buch ist in einer einfachen, präzisen Sprache erzählt. Auch in der Durchdringung der Zeitenebenen beweist Fatah viel Kunstverstand. Wenn Kerim aus den Bergen zurückkehrt, ist das Eigentliche jener prägenden Zeit unter den Gotteskriegern noch gar nicht erzählt. Diese Szenen werden ihn als Erinnerungen ebenfalls erst in Berlin heimsuchen. Er hat mitgemacht bei bestialischen Morden an Zivilisten. Er hat das Kommando für die Auslösung der Explosion gegeben, als sie den kindlichen Hamid, eine Kriegswaise, als ferngesteuerte Bombe losschickten. Er hat Mukhtar gefilmt, einen alten Kämpfer mit Blutdurst in den Augen, seit er mit angesehen hat, wie afghanische Jungen unter russischen Panzerketten zerquetscht wurden. Hat ihn gefilmt, als er allen Bewohnern eines Dorfes die Kehle durchschnitt, und die zur Abschreckung gedachten Bilder fürs Internet bearbeitet.
Die Schleppnetze des internationalen Terrors reichen bis nach Berlin. Beeindruckend schildert Fatah die Radikalenkreise der Exilanten, sei es im Umkreis der Uni-Mensa oder draußen in den Gewerbegebieten, wo es zwischen leeren Fabriken volle Gotteshäuser gibt. Hier trifft man auf unheilbrütende Gestalten wie Amir, einen kraftsportgestählten Araber jener Art, wie er in U-Bahnen auf Kollisionskurs unterwegs ist. Es ist Kerim, der ihn mit seiner Geschichte fasziniert und schließlich vom Internetcafé in die Moschee zieht. Schnell wird der Sohn eines Einwanderers zum Fundamentalisten - zu einem Mann, der "nach Verwandlung lechzt" und zu allem bereit ist.
Fatah bietet beklemmende Einblicke in eine Parallelgesellschaft. Und es geht nicht gut aus für Kerim, diesen schweigsamen Migrationsmelancholiker. Die Vergangenheit sucht ihn heim. Eines Tages trifft er jemanden in Berlin, den er nicht hätte treffen dürfen. Jemand, der ihn daran erinnert, dass er einst selbst zum "Verräter" wurde.
Sherko Fatah: "Das dunkle Schiff". Roman. Verlag Jung und Jung, Salzburg/Wien 2008. 440 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Trotz seiner spannenden Geschichte hat Sherko Fatahs Roman "Das dunkle Schiff" den Rezensenten Andreas Fanizadeh nicht recht überzeugt. Das liegt zum Teil daran, dass ihm all das, was Fatah seinem Protagonisten, dem kurdisch-irakischen Kerim zustoßen lässt, schlicht zu viel wird: Kerim wächst unter der Gewaltherrschaft Saddams auf, macht später, als die Amerikaner im Irak einmarschieren, eine Karriere als Glaubenskrieger und landet schließlich als illegaler Migrant in Berlin. Dabei lässt sich die psychologische Entwicklung des Protagonisten jedoch nicht recht nachvollziehen, wendet der Rezensent ein. Fatah stelle seinen Helden durchgehend als Opfer äußerer Einflüsse dar, ohne über sein Innenleben Aufschluss zu bieten. Dadurch erscheinen Fanizadeh die Wandlungen Kerims unglaubwürdig und erfunden. Den Helden stets nur als Opfer äußerer Umstände darzustellen erscheint Fanizadeh literarisch wie politisch zu schlicht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Ein für die deutsche Gegenwartsliteratur ungewöhnlicher, herausragender Roman." Die Welt