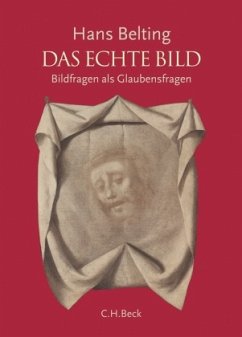Was ist ein echtes Bild? Hans Belting sucht unser Bedürfnis nach dem wahren, authentischen Bild, das wir vor allem in der Wissenschaft verlangen, zu ergründen. Er zeigt, wie sehr die europäische Geschichte der Religion bis heute unsere Bildbegriffe und unser Bilddenken bestimmt. Belting schlägt souverän den Bogen von der Spätantike bis hin zu Fernsehen und Film unserer Tage. Dabei präsentiert er dem Leser eine neue Sicht auf die Geschichte des Bildes und setzt dessen Aktualität in ein ungewohntes Licht. Hans Belting setzt sich hier mit Fragestellungen seines zum Klassiker gewordenen Werks Bild und Kult erneut auseinander. Sein altes Thema, die Bedeutung des Bildes in der europäischen Kultur, beleuchtet er hier jedoch im Licht der von ihm begründeten Bild-Anthropologie. Dabei zeigt sich, wie stark unser Bilddenken auch heute noch in den alten Debatten der Religion verwurzelt ist. In den Kontroversen um Körper und Zeichen oder um Bild und Wort hat sich eine spezifisch europäische Kultur entwickelt, deren christliche Prägung auch in der Moderne noch fortlebt. Belting richtet seinen Blick unter anderem auf zwei Schwellenzeiten, von denen die europäische Kultur geprägt wurde: zum einen die Spät-antike, in der sich das Christentum formierte, und zum anderen die Reformation und den Konfessionsstreit, der tiefe Spuren im neuzeitlichen Weltbild hinterließ. Es ist das Anliegen des Buches, Bildwissenschaft als Kulturwissenschaft zu etablieren und dabei Religions- und Bildgeschichte in einen überraschenden Bezug zueinander zu bringen.

Ein Vademecum: Hans Belting diskutiert echte Bilder und falsche Körper / Von Michael Diers
Das Frontispiz des Buches von Hans Belting zeigt eine ungewöhnliche Szene. Ein Maler, die Rechte auf die Brust gelegt, in der Linken die Palette und einen Pinsel vorweisend, ist unter das Kreuz getreten und blickt voller Inbrunst zum Gekreuzigten auf. Das stumme Zwiegespräch läßt sich als fromme Andacht, zugleich aber auch als Fachdiskurs zwischen Künstler und Gottessohn auffassen. Im Gemälde Francisco de Zurbaráns, das diese Unmittelbarkeit stiftet, fallen heilige Stätte und profanes Atelier in eins. Das Farbenspektrum der Palette enthält sämtliche Inkarnat-, Braun- und Schattentöne, die ein Maler benötigt, um den Crucifixus wie gezeigt darzustellen.
Handelt es sich demnach um einen leibhaftigen oder um einen künstlichen Körper, um ein Bild, eine Erscheinung oder eine reale Begegnung? Die ungeheure Begebenheit, die den Maler an die Stelle des wortmächtigen Täufers Johannes nachrücken und ihn als einen anderen Pygmalion auftreten läßt, kann man nicht in rationalistischer Weise, vielmehr nur in theologischer, genauer bildtheologischer Hinsicht ausloten. Ebendieser Aufgabe unterzieht sich Hans Belting, indem er, wie es im Untertitel seines Buches heißt, "Bildfragen als Glaubensfragen" behandelt.
Fragen nach dem Status und der Qualität eines Bildes bewegen die gelehrte Welt seit rund zweieinhalb Jahrzehnten intensiv. Dazu sind Zahlreiche bildwissenschaftliche Ansätze entstanden, und sie konkurrieren inzwischen miteinander um die Bestimmung des altneuen Mediums, das selbst Unsichtbares sichtbar zu machen versteht. Die Kunstgeschichte trägt wesentlich dazu bei, dem neuen Fach den historischen Boden einzuziehen. Hatte Gottfried Boehm im Titel seiner weit verbreiteten, 1994 publizierten Anthologie aus vornehmlich philosophischer Perspektive danach gefragt, was ein Bild sei, und mit dieser scheinbar schlichten Frage einen wichtigen Stein des Anstoßes zur transdisziplinären Diskussion geliefert, so wartet der erste Satz des Belting-Buches zehn Jahre später mit einer neuen Frage auf: "Was ist ein echtes Bild?"
Die Spezifikation überrascht und leuchtet nicht unmittelbar ein. Ist sie vergleichbar grundlegend? Und überdies aktuell? Echtheit ist gemeinhin eher eine Kategorie des (Kunst-)Marktes und der Werbung, keine der hehren Ideenwelt. Heute meint "echt" in der Regel nur den Gegensatz zu falsch, künstlich oder nachgemacht. Ursprünglich aber entstammt das Adjektiv der Rechtssprache und bedeutete "recht" im Sinne von gesetzmäßig. In dieser Etymologie klingt bereits von fern her jener Streit um das rechte Bild an, der jahrhundertelang die religiösen Bilddebatten geprägt hat. Bis heute begleiten uns Bildbegriffe, Bildwünsche und Bildängste, die einst in der Religion, wie es bei Belting heißt, "ihren Sitz im Leben" hatten.
Der Rekonstruktion dieser Standards und Maßgaben, welche die Vorstellungen in den Köpfen ebenso wie die konkreten Darstellungen bestimmt haben, ist das Buch gewidmet. Auf den knapp zweihundertfünfzig Seiten seiner Untersuchung stellt der Autor deren Fortleben unter schlagenden Beweis. Verlangt wird dabei vom Leser nur, daß er sich auf eine Zeitreise begibt. Dabei fällt es Belting leicht, die Brücke in die Geschichte zu schlagen, da er es als (Kunst-)Historiker sachlich wie als Autor sprachlich bestens versteht, die Jetztzeit auch dann nicht aus dem Blick zu verlieren, wenn er gerade von den Bildmythen um wundertätige Tuchbilder des sechsten Jahrhunderts oder von der Bildpolitik mit gedruckten Porträts des sechzehnten Jahrhunderts spricht.
Spätantike und Frühe Neuzeit bilden historisch die beiden Brennpunkte des Bandes, der seiner methodischen Fragestellung nach an Beltings im Jahr 2001 vorgelegte "Bildanthropologie" und dem Gehalt nach an dessen Standardwerk "Bild und Kult" von 1990, das eine "Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst" geliefert hat, anknüpft. Fast könnte man sagen, es handle bei dem vorliegenden Buch sich um eine Revision von "Bild und Kult" aus bildanthropologischem Blickwinkel; der Gegenstandsbereich ist eng verwandt, wird aber gänzlich neu gesehen.
Bilder, so Beltings These, sind durch die Ambivalenz zwischen Medialität und Körperlichkeit bestimmt, die Grenze zwischen Bild und körperlicher Welt ist fließend, und der Körper selbst ist ein "Ort der Bilder". Wenn man die Parameter Bild, Körper und Medium zur Grundlage seiner Forschung gewählt hat und diese Trias in den letzten Jahren zunächst entlang zeitgenössischer und moderner sowie außereuropäischer Kultur- und Kunstzeugnisse diskutiert hat, dann ist es nur konsequent, gerade auch dem historischen Ausgangspunkt und der Grundlegung dieser Idee einer geradezu existentiellen Relation der drei Kategorien untereinander nachzuspüren. Folglich kehrt man, die europäische Kultur in den Blick genommen, zur späten Antike und zum frühen Christentum zurück, als durch eine neue Medienpraxis auch das Bild als Instrument und Argument in die religiösen Dispute Einzug hielt und damit neben das Wort und die übermächtige Schrift in einer ringsum bilderlosen oder von heidnischen Praktiken geprägten Kultur trat.
Gott war Mensch geworden, hatte Gestalt angenommen und war somit sichtbar geworden. Allein die "echten" Bilder dokumentieren die veritable Körperlichkeit. Der Körper Christi, insbesondere sein Antlitz, wurde zur Richtschnur all jener Bilder, die sich authentisch von ihm herleiten. Während in der Spätantike um das Recht der Bilder und um ihre Wahrheit aufs heftigste gerungen wurde, versuchte die Reformation in einer Gegenbewegung der Bilderverehrung, die ihr als heidnische Idolatrie erschien, schlichtweg den Garaus zu machen, indem man die Bild- und Kunstwerke schlicht zertrümmerte und das vermeintlich unverbrüchliche Wort wieder ins Recht zu setzen suchte.
Es gelingt dem Verfasser glänzend, Geschichte gegenwärtig zu machen und im gleichen Zuge die Gegenwart historisch abzurücken. Die Fülle der diskutierten Beispiele und Aspekte, darunter Bild und Zeichen, Idol, Ikone, Corpus Christi, Vera Icon und Volto Santo, Maske, Gesicht und Karikatur, ist beeindruckend. Die zahlreichen, qualitätsvollen Abbildungen stützen die Argumentation und regen dazu an, auch punktuell in den Text einzusteigen, der angesichts der Ikonolatrie der Gegenwart als Vademecum fungiert.
Bleibt noch die Frage nach Zurbaráns einsamem Maler unter dem Kreuz zu stellen, der sein Gegenüber ebenso flehentlich ansieht wie wohlgefällig betrachtet. Kein Zweifel, daß sein Modell echt, das heißt zumindest wahr im Sinne der Kunst ist.
Hans Belting: "Das echte Bild". Bildfragen als Glaubensfragen. C. H. Beck Verlag, München 2005. 240 S., Abb., geb., 29,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Eindrucksvoll findet Andreas Tönnesmann dieses Buch, in dem der Kunsthistoriker Hans Belting der Geschichte und dem Status des Bildes seit der Spätantike nachgeht. Dabei greife er auf ältere Forschungen zur Genese des christlichen Bildes zurück, verknüpfe diese aber mit dem Anspruch, einen anthropologisch verankerten Bildbegriff zu etablieren. Damit wolle Belting kunstgeschichtliche Erfahrung für die kulturelle Praxis der Gegenwart neu verfügbar machen. Aktuelle Probleme im Umgang mit Bildern sieht Tönnesmann vor allem in der Einleitung behandelt, wobei er einen kulturkritischen, wenn auch nicht kulturpessimistischen Impuls des Autors nicht verschweigen will. "Imposant" erscheint ihm, was Belting in den folgenden Kapiteln an Materialien erschließt, um in die höchst konfliktreiche Frühgeschichte christlicher Bildkultur einzuführen. Ausführlich widmet er sich Beltings "fesselnder Darstellung" der Genese des Christusbildes. Insgesamt würdigt Tönnesmann diese Studie als "gelehrtes, durchaus auch belehrendes Buch", das sich als Warnung vor unkontrolliertem Bildhunger und zugleich als Anleitung zu einem reflektierten Genuss der Betrachtung verstehen lasse.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH