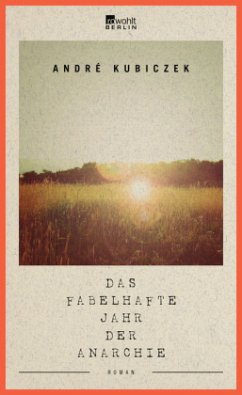April 1990, die DDR löst sich auf. Die Älteren sind voll Sorge, die Jungen aber leben die Liebe und die Freiheit, genießen den freundlichen Ausnahmezustand. Im März fiel die Entscheidung für die Wiedervereinigung, im Juli wird die Währungsreform kommen. Die Zukunft mit ihren bürgerlichen Kategorien ist in diesen Tagen weiter entfernt als das Pleistozän. Ulrike und Andreas, ein junges Paar aus Potsdam, kehren der Stadt - enttäuscht vom Ausgang der ersten freien Wahlen - den Rücken und bauen in einem kleinen Dorf in der Niederlausitz an ihrem privaten Idyll: Sie renovieren, legen einen Garten an, schließen Freundschaft mit dem Schäfer und einem fahnenflüchtigen sowjetischen Soldaten. Sie sind frei für den Moment. Nur Ulrikes Bruder Arnd bringt hin und wieder Nachrichten aus der Realität mit - und vor allem Unruhe in den Ort. Als die nahe Kreisstadt sich für den Geldumtausch rüstet, geht einer der Bankcontainer in Flammen auf - und das fabelhafte, kurze Jahr der Freiheit für die Freunde zu Ende.
Der erste Roman über die schönste Anarchie unserer jüngeren Geschichte - und ein Buch über das wunderbare, ängstliche Glück, das jedem Anfang innewohnt.
Der erste Roman über die schönste Anarchie unserer jüngeren Geschichte - und ein Buch über das wunderbare, ängstliche Glück, das jedem Anfang innewohnt.
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Etwas altmodisch in der Formulierung und auch etwas langweilig, was das Geschehen betrifft, findet Ulrich Seidler André Kubiczeks Roman über einen Haufen Aussteiger im Osten Deutschlands anno 1990 und ihren Weg in die totale Ereignislosigkeit. Dass die für den Leser hautnah erfahrbare Wiederholung hier Teil der beschriebenen Sache ist, weiß Seidler zwar, mitunter geht es ihm im Text aber allzu behäbig zu, wenn die Protagonisten das x-te Bier am Lagerfeuer köpfen. Das Ausstellen des Scheiterns privater Utopien bietet für Seidler dennoch genügend Material zum Nachsinnen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Eskapismus als Trend, Brandenburg als Zuflucht: André Kubiczeks Roman
Wie steht es nun also mit dem Traum, in Brandenburg aufs Land zu ziehen? Der Krisenreporter Moritz von Uslar und der schmähliedernde Kabarettist Rainald Grebe würden wohl abraten. Die schöne Literatur hingegen träumt sich immer wieder gern mal "raus aus Berlin, Landhaus, Herrenhaus, Gutshaus, Linden davor, Kastanien dahinter, See märkisch, drei Morgen Land mindestens" (so in Judith Hermanns "Sommerhaus, später"), und auch das aktuelle Buchjahr schickt uns tief in die Mark: Mit Ulrike Kolb konnte man an einem Wochenendseminar für Schlaflose auf einem abgelegenen Landgut teilnehmen, mit Sasa Stanisic eintauchen in den See des fiktiven Fürstenfelde.
Spätestens mit André Kubiczeks Roman "Das fabelhafte Jahr der Anarchie" wird es Zeit für einen neuen Gattungsbegriff: Brandenburger Eskapismus. Auch hier wird der Traum vom idyllischen Häuschen fern der Stadt gelebt. Allerdings nicht in der Gegenwart, sondern im Sommer 1990, und zwar von drei jungen Menschen in der ausgehenden DDR, deren Traum vom Kommunismus gerade zerschellt ist: Andreas, genannt "Ändie", und sein Freund Arnd, beide Anfang zwanzig, haben im Potsdam der Wendezeit gerade noch Flugblätter für eine Räterepublik verteilt, "dadaistische Plakate geklebt" und in besetzten Häusern von der Graswurzelrevolution geschwärmt, bis die erste freie Volkskammerwahl im März ihrem Bündnis "Demokratischer Aufbruch" gerade mal ein knappes Prozent der Stimmen bescherte.
Nach dieser Schlappe sagt Arnds Schwester Ulrike klipp und klar, was die Stunde geschlagen hat: "Keiner will euch. Wie sieht's also aus mit dem Landleben, mein Freund?" Da Ändie die Ulrike sehr gern und diese praktischerweise vom Opa einen Hof in der Lausitz geerbt hat, packt man ein paar Sachen zusammen, schmeißt sie in den Ello (hier beginnt der ostalgische Zug des Romans), und fertig ist das Setting für eine Sommergeschichte im Örtchen Neu Buckow, von der viel schon im ersten Satz zusammengefasst scheint: "Isses nicht herrlich, Ändie?"
Die Herrlichkeit malt Kubiczek hübsch aus: Die Alleen reichen bis zum Horizont, Ulrikes Haar schimmert honigblond, das renovierungsbedürftige Haus ist eine verlockende Aufgabe. Wenn man von der mal genug hat, geht man abends im beschaulichen "Heidekrug" einen trinken, und eine etwas miesepetrige Krämerin namens Frau Domaschke, die einem die Hühner aus dem eigenen Familienbesitz zurückverkauft, ist auch schon das Schlimmste, was das junge Glück dort auszustehen hat. Ulrike und Ändie gehen in dieser Idylle zunächst ganz auf.
Der Eskapismus des jungen Liebespaars wird im Roman aber auch offen kritisiert, nämlich von Ulrikes Bruder Arnd, der immer seltener zu Besuch kommt und sich derweil in Potsdam zu radikalisieren scheint. Er will sich mit den Gegebenheiten der neuen Zeit noch nicht abfinden und fordert seine Freunde zum Kampf gegen das neue System auf, schimpft sie Kleinbürger. Andreas hingegen, der die ganze Geschichte aus ferner Rückschau erzählt, erinnert sich an den Sommer als anarchistische Episode der eigenen Biographie, die er wohl auch deshalb ein bisschen verklärt, weil sie lange vorbei ist.
Wenn man sich auf das gemächliche Tempo dieser Erzählung eingelassen hat, die auf gewisse Nichtigkeiten drei- und viermal zurückkommt und jeden Grashalm zweimal umdreht, wird man ganz gut unterhalten, beginnt aber auch mit den Protagonisten zu warten, dass die Hühner endlich Eier legen.
Kurios ist allerdings, dass dieser Roman einer Flucht vor dem Kapitalismus sich bisweilen stark anlehnt an dessen affirmative literarische Ausformung: Es wirkt, als wolle Kubiczek geradezu ein Spiegelbild zu solchen Werken der Popliteratur erzeugen, die im Aufzählen von westlichen Produkten und Markennamen schwelgen. Hier sind es vor allem die Nahrungsmittel der DDR, die gewürdigt werden: Immer wieder wird Schmalzfleisch aus der Dose gebraten, im Einkaufsbeutel aus Dederon baumeln Schmelzkäse mit Salami-Geschmack, Maizena-Speisewürze und drei Schachteln Club-Zigaretten.
Einmal wird das allerdings auch ganz nett ironisiert: Als Arnd Frau Domaschke nach einer Spezialität namens "Scomber Mix" (vulgo: Dosenmakrelen in Tomatensauce) fragt und diese pikiert kontert: "Nee, Junge, so wat gibt's nur in der Stadt", sagt Ulrike zu ihr: "Na, dafür sind wir letzten Herbst aber nicht auf die Straße gegangen, wa, Frau Domaschke?" Von solchen Szenen hätte der Roman auch gern noch ein paar mehr haben können.
JAN WIELE
André Kubiczek:
"Das fabelhafte Jahr
der Anarchie". Roman.
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2014. 270 S.,
geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Dem "fabelhaften Jahr der Anarchie" setzt André Kubiczek ein so köstliches wie melancholisches Denkmal. Kubiczek ist ein Meister des Dialogs, der schnodderige Esprit seiner halben Helden wunderschön. Süddeutsche Zeitung
Kubiczek verfügt über Humor, Ironiefähigkeit und ein großes Gespür für Dialoge. Die weltgeschichtliche Erschütterung packt er bewusst in ein großes Federkissen. Der Tagesspiegel