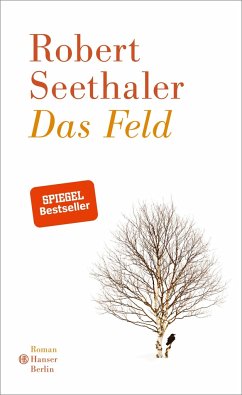Wenn die Toten auf ihr Leben zurückblicken könnten, wovon würden sie erzählen? Einer wurde geboren, verfiel dem Glücksspiel und starb. Ein anderer hat nun endlich verstanden, in welchem Moment sich sein Leben entschied. Eine erinnert sich daran, dass ihr Mann ein Leben lang ihre Hand in seiner gehalten hat. Eine andere hatte siebenundsechzig Männer, doch nur einen hat sie geliebt. Und einer dachte: Man müsste mal raus hier. Doch dann blieb er. In Robert Seethalers neuem Roman geht es um das, was sich nicht fassen lässt. Es ist ein Buch der Menschenleben, jedes ganz anders, jedes mit anderen verbunden. Sie fügen sich zum Roman einer kleinen Stadt und zu einem Bild menschlicher Koexistenz.

© BÜCHERmagazin, Anna Gielas

Robert Seethaler ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftsteller. Nach seinem Weltbestseller "Ein ganzes Leben" erscheint nun "Das Feld", ein Gegen- und Ergänzungsstück zugleich.
Die siebtletzte Seite dieses Romans endet mit dem Satz: "Von nun an geht es schnell." Nicht nur schnell zum Schluss des Buchs, sondern auch mit Connie Busses Schicksal. Und da wir zuvor bereits 27 andere Schicksale von Robert Seethaler erzählt bekommen haben, wissen wir, wohin es auch Connie Busse führen wird: auf den Friedhof, "das Feld", wie die Einheimischen ihn nennen. Daher hat der Roman seinen Titel, und bis auf eine sind alle seine dreißig Stimmen die von Toten.
Die überlebende ist die des Erzählers. Nur im ersten Kapitel ist sie zu hören, wenn sie uns nach Paulstadt führt, zu Harry Stevens (von dem wir da noch nicht wissen, dass er so heißt) auf eine Bank unter einer Birke inmitten des kommunalen Gräberfelds. Jeden Tag sitzt Harry hier, "als junger Mann wollte er die Zeit vertreiben, später wollte er sie anhalten, und nun, da er alt war, wünschte er sich nichts sehnlicher, als sie zurückzugewinnen". Solche lapidaren Sätze mit so viel Wahrheit und Weisheit schreibt nur Seethaler.
Er schreibt auch, mit Blick in Harrys Kopf: "Er dachte, dass der Mensch vielleicht erst dann endgültig über sein Leben urteilen konnte, wenn er sein Sterben hinter sich gebracht hatte." Aber diese Kunst beherrscht natürlich niemand. Außer der Literatur, zu deren Repertoire schon immer - und bevorzugt - Reisen ins Totenreich gehörten, von Homer über Dante bis zu Jenny Erpenbeck. Und in seinem vorherigen Roman, "Ein ganzes Leben", erschienen 2014 und ein Erfolg weit über die deutschen Sprachgrenzen hinaus, hatte Seethaler zwar nicht das Jenseits betreten, aber aus einer Perspektive jenseits des Lebens seines Protagonisten Andreas Egger erzählt - wie man es eben machen muss, wenn es titelgemäß um ein ganzes Leben geht. Denn das kann aufs Sterben nicht verzichten.
Ganze Leben sind nicht das Thema von "Das Feld". Es ist vielmehr das Stimmkonzert einer Provinzstadtbevölkerung, deren jede einzelne Persönlichkeit unentbehrlich ist fürs kleine Ganze. Einige der 29 Gestorbenen bekommen nur Kapitel mit einer einzigen Seite, das umfangreichste zählt deren sechzehn, und es ist auffällig, dass die fünf längsten sämtlich Frauen gewidmet sind, die aber wiederum insgesamt in der Minderzahl sind (zwölf gegenüber siebzehn Männern). Man muss sich den Aufbau dieses Buchs so genau ansehen, denn Robert Seethaler ist ein formbewusster Autor. Und nacherzählen kann man 29 Einzelschicksale in keiner Rezension. Ja, eigentlich auch in keinem Roman.
Doch "Das Feld" tut es, und Seethalers Trick besteht darin, dass er jeweils einzelne Episoden aus den individuellen Leben herausgreift, die für diese besonders bezeichnend sind. Gelegentlich sind Kapitel miteinander durch personelle Überschneidungen verknüpft. So erfährt man zum Pfarrer Hoberg nicht nur aus seinem eigenen Mund (alle Kapitel bis auf das einleitende sind in Ich-Perspektive gehalten) von seinem seltsamen Ende, sondern eben dieser Seltsamkeit wegen auch von anderen Erzählern. Sie sind sich sämtlich einander Zeitgenossen; die Handlungsdauer, begrenzt durch ihr Lebensalter, umfasst die Jahre vom Zweiten Weltkrieg bis in die unmittelbare Gegenwart. Einige Personen lieben sich gegenseitig.
Niemand erwarte jedoch, dass hieraus ein Kleinstadtroman entstehe. Paulstadt bleibt blasser als jeder einzelne seiner 29 Bewohner, die hier zu Wort kommen. Die Ortschaft dient allein als größerer Rahmen für Seethalers Personalbasis, und der Friedhof als kleinerer sorgt dann für die Auswahl daraus. War Andreas Egger im "Ganzen Leben" ein Romanheld im klassischen Sinne (literarisch gemeint, nicht biographisch), so wird in "Das Feld" ein ganzes Gefüge in den Blick genommen, lauter Leben, um die es sämtlich leise geblieben wäre, hätte sich nicht Seethalers Phantasie und Kompositionsgeschick ihrer angenommen. Das liest sich anders als "Ein ganzes Leben", komplexer, herausfordernder, aber der Tonfall ist geblieben und damit das Charakteristikum dieses Erzählers. Keine Rede davon, dass er sich dreißig unterschiedliche Stimmlagen für seine dreißig Kapitel gesucht hätte.
Existentiell muss man diesen aufs Gerippe der Sprache reduzierten Tonfall nennen, hier ist kein Raum für opulente Rhetorik, geschweige denn für Sprachspielereien. Ein harscherer Bruch gegenüber Seethalers Frühwerk, den Romanen "Die Biene und der Kurt", "Die weiteren Aussichten" und "Jetzt wirds ernst", erschienen zwischen 2006 und 2010, ist kaum denkbar, denn diese Bücher waren lustvolle Farcen, Typen- statt Charakterstudien, und als jeweils skurrile Glückssuchen höchst amüsant. Der Umschwung kam 2012 mit "Der Trafikant", Seethalers erster Geschichte, die in die Vergangenheit zurückführte und dann gleich in die schlimmste, in die NS-Zeit, vorgeführt am Beispiel Wiens nach dem "Anschluss". Nunmehr rückten größere Themen in den Fokus, die Menschlichkeit an sich stand in Frage. Dadurch zog ein Ernst in Seethalers Prosa ein, der seinen passenden Ausdruck in Kargheit suchte, die aber "Der Trafikant" mit einem prominenten Protagonisten wie Sigmund Freud noch nicht erreichen konnte. Konsequenterweise suchte sich Seethaler für "Ein ganzes Leben" dann einen Allerweltshelden, der tatsächlich in aller Welt als Held erkannt wurde: weil dessen Erlebnisse so viel über die Befähigung des Menschen aussagen, sein Schicksal zu meistern. Und sei es nur vor sich selbst.
Das mag ein utopischer Zug in Seethalers Werk sein, doch mit "Das Feld" ist ihm nun nicht einmal mehr das Gelingen der vielen Lebensentwürfe interessant, sondern die Würde, die selbst noch im Scheitern - und es scheitern etliche Paulstädter, auch vor sich selbst - unberührt bleibt. Diese Liebe Seethalers zu seinen Figuren wiederum berührt bei der Lektüre. Und wenn man dann auf Seite 233 den eingangs zitierten Satz liest: "Von jetzt an geht es schnell", dann schluckt man, denn er gilt ja nicht nur für Connie Busse, sondern auch für die eigene Lektüre von "Das Feld", die man sich länger wünscht, so viel länger.
ANDREAS PLATTHAUS
Robert Seethaler: "Das Feld". Roman.
Hanser Berlin Verlag, Berlin 2018. 239 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Andreas Platthaus könnte ewig weiterlesen in Robert Seethalers Reise ins Totenreich. Leider sind es "nur" 29 Tote, die der Autor zu Wort kommen und auszugsweise aus ihrem Leben berichten lässt, findet Platthaus. Auch wenn die Provinz, in der diese Toten lebten, kaum fassbar wird und Seethaler den Figuren immer die gleiche (seine) Stimme leiht, ihre miteinander verbundenen Geschichten werden für den Rezensenten umso plastischer. Seethalers Fantasie und Konstruktionsgeschick scheinen Platthaus einmal mehr bemerkenswert, ebenso sein reduzierter Ton. Und wie der Autor seinen Figuren Würde verleiht, sogar im Scheitern, berührt Platthaus tief.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Geht doch: Dieses Buch über die Toten eines Dorfes beweist, dass subtile literarische Qualität und Bestseller-Erfolg sich nicht ausschließen müssen." Die Zeit, 04.10.2018 "Wenn ich auf mein Leben irgendwann zurückblicke, wovon würde ich erzählen? [...] Genau das macht die Qualität dieses Buches aus. Die sanfte Wucht des Persönlichen, die in jeder einzelnen Geschichte liegt. [...]Der österreichische Autor ist einer meiner Lieblingsautoren." Christine Westermann, WDR 2, 09.09.18 "Selten war ein Totentanz unterhaltsamer!" Denis Scheck, ARD druckfrisch, 02.09.18 "Einer jener raren Romane, die einen existentiell berühren und verändern können." Denis Scheck, SWR, 19.07.18 "Seethaler achtet darauf, Erwartungen nicht zu simpel zu bedienen ... Seethalers Humor ist nüchtern wie sein Sinn für das Drama." Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau, 27.06.18 "Das alles ist so wunderbar arrangiert, ... dass man mit dem Lesen eigentlich gar nicht mehr aufhören möchte, dass man traurig ist, zum Schluss zu kommen ... Das was er beherrscht wie wenig andere Autoren in der deutschen Literaturgeschichte, ist, allen seinen Figuren eine ganz tiefe Würde zu verschaffen." Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.06.18 "Robert Seethaler ist ein Meister des unheroischen Erzählens. In ihren besten Momenten erinnert Robert Seethalers Erzählung von der sanften Schönheit des Scheiterns an den Literaturheiligen Robert Walser." Iris Radisch, Die Zeit, 07.06.18 "Wenn ein Autor 29 Tote ihr Kleinstadt-Leben erzählen lässt; wenn es ihm gelingt, den Leser noch mit der banalsten Episode zu berühren, ohne aus der Jenseits-Nummer Kitsch werden zu lassen; wenn er die Biografien Stück für Stück zusammenwachsen lässt und einen Roman daraus macht - dann muss das ein großer Erzähler sein. Seethaler eben." Stephan Hebel, Frankfurter Rundschau, 22.06.18 "Robert Seethaler ist der große Zimmermann der deutschsprachigen Literatur." Philipp Haibach, Die Welt, 03.06.18 "Dieser leiseAutor kann Stille und das Ende beschreiben, wie niemand sonst ... Seethaler ist ein Meister der unsentimentalen Einfachheit, des Augenblicks, des Ephemeren, alles schwebt, alles ist leicht, auch das Schwere, und alles geht zu Ende, irgendwann, irgendwie, und dazwischen leben wir unsere Leben." Elke Heidenreich, Focus, 02.06.18 "Formvollendet. Mit seiner schnörkellosen, poetischen Sprache schafft Seethaler es, jedem Lebensentwurf seine Berechtigung zu geben. Verlust, Liebe, Hoffnung und Einsamkeit - die Emotionen der Menschen so unpathetisch präzise zu beschreiben ist große Kunst, die Seethaler mit seinem genauen Blick meisterhaft beherrscht." ZDF Aspekte, 01.06.18