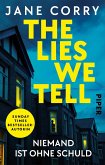Die Alpen, Ende des 19. Jahrhunderts, kurz vor Winterbeginn. Ein Fremder kommt in ein einsam gelegenes Hochtal. Er sei Maler und suche Quartier. Die Bewohner sind misstrauisch, lassen sich aber von seinem Gold überzeugen. Der erste Schnee schneidet das Tal von der Außenwelt ab. Das Leben im Dorf kommt zur Ruhe, man hat sich an den Fremden gewöhnt. Doch dann gibt es den ersten Toten, bald darauf einen zweiten. Eine dramatische Geschichte von Liebe und Hass, Schuld und Vergeltung nimmt ihren Lauf.

Wenn sich Kafka mit Howard Hawks ein Buch ausdenken würde - das könnte es sein: Thomas Willmanns Debüt bewältigt meisterhaft Genres und Stile von Western bis Heimatroman. Und eine überaus raffinierte Geschichte erzählt es auch.
Zunächst heißt er nur "der Fremde". Wir sehen ihn auf einem Maultier in die Berge reiten. Bis Mittag will er sein Ziel erreichen, ein Dorf im Hochtal, von dem kaum jemand weiß. Ein Bild auf Großleinwand: Wie ein Westernheld schreitet er durch einen schmalen Felsenkessel ein, gehüllt in einen hellen Staubmantel, dazu ein Paar ausgetretene Lederstiefel. Thomas Willmanns Debüt "Das finstere Tal" startet geradezu cinemaskopisch. Im Hintergrund wäre Musik vorstellbar - umschmeichelnd, bedrohlich. Oder auch nur Geräusche, welche die kühle Bergstille durchbrechen: Schnauben, Atmen, unregelmäßiges Traben. Willmann, 1969 in München geboren, Kulturjournalist und Dozent, liebt Western und Filmmusik. Aus der Leidenschaft ist ihm jetzt eine Prosa erwachsen, die bis zum Schluss fesselt. Sie wirkt wie filmisch inszeniert, "Spiel mir das Lied vom Tod" gekreuzt mit dem zwiespältigen Flair, den alte Heimatromane verströmen. Aus Letzteren hat Willmann die liebliche Fadenscheinigkeit jenes Dorfes destilliert, das der Fremde aufsucht. Doch merkt man bald, dass die geschlossene Ordnung trügt.
Die Geschichte spielt in den Alpen. Satz für Satz nimmt man von der malerischen Gegend Besitz. Sinnlich dringt Natur in diesen Text; die Luft, "gläsern bis zum Horizont, fährt mit metallischem Geruch in die Nase". Mit ihr atmet man alte Zeit, vielleicht 19. Jahrhundert. Die Sprache knarzt wie altes Gebälk und ist doch von großzügiger Leichtigkeit. Sie führt geradewegs in die eisige Kälte dieses Hochtals, hinein in jenes finstere Dorf. Im Kern, das spürt man früh, fault es; vermutlich schon seit Jahrzehnten. Ebendeshalb wird jeder Fremde hier misstrauisch beäugt. Die Mentalität der Menschen hat sich seit Generationen ins Land gefräst. Die Siedlung hat etwas "trutzig Gedrängtes", die Höfe liegen in "träger Pracht", die Haut der Bewohner ist "ledrig", die Hände "schwielig und sehnig". Die Körper der Männer, denen der Fremde zuerst begegnet, spannen sich, "wie zum Sprung bereit". Was will der Mann in diesem Dorf?
Der Fremde ist ein literarischer Topos mit Tradition. Seine Wirkung steht und fällt mit dem perspektivischen Spiel, das der Autor zu entfachen weiß, und bestenfalls gelingt es dann - wie hier - das Fremde in uns selbst zu berühren. Willmann vertraut personalem Erzählen. Er weiß den Blick des Lesers in eine Pendelbewegung zu versetzen. Und so lässt er uns erst mal im Ungewissen. Wir starren neugierig durchs Wirtshausfenster, um den Fremden, der sich als Landschaftsmaler ausgibt und gut fürs Quartier zahlt, in Augenschein zu nehmen. Und wir betrachten umgekehrt mit Greider, wie der Fremde inzwischen heißt, die Dorfbewohner. Schnell erkennt er das Zentrum der Macht, den herrischen Brenner-Bauern mit seinen sechs Söhnen. Lange nährt sich diese geduldig erzählte Prosa aus dem Schweigen, das die Fronten trennt. Wenn Worte fallen, dann karg und bestimmt. ",Grüß dich.' ,Grüß euch', antwortete der Neuankömmling, mit einem langsamen, unbeugsamen Blick durch das Halbrund. ,Bist fremd hier.'"
Allmählich aber wechseln Tempo und Dramaturgie. Greider, untergebracht bei einer Witwe und deren heiratsfähiger Tochter, sichtet die Region mit Skizzenblock in immer größeren Maßstäben. Unauffällig studiert er minutiös Mensch und Land. So gehen die Tage dahin. Es fällt der erste Schnee. Er schneidet dem im Dorfe mittlerweile geduldeten Fremden den Rückweg ab, was ihm allerdings nicht zu missfallen scheint. Da kommt es zu mysteriösen Todesfällen. Beim ersten Brennersohn glaubt man noch an einen Unfall bei Baumarbeiten. Dann wird der zweite Brennersohn tot gefunden.
Willmann legt keine leichte Fährte zu Täter und Motiv. Vielmehr führt er die Blicke des Lesers zunächst verwirrend durchs Tal. Diese verengenden und erweiternden Kamerafahrten sind der eigentliche Trumpf des Romans. Mal sieht man den Fremden am Horizont reiten; dann wieder in Großaufnahme herangezoomt, wie er das Gesicht des ersten Toten betrachtet und dessen entstellte Züge mit grausamer Sorgfalt aufs Blatt überträgt. Weiterhin bleibt man unschlüssig über Greiders Charakter, ertappt sich dabei, wie die Sympathien wechseln. Im Dorf läuft das Leben im Takt des Kirchenjahrs - bis weitere Vorfälle den Reigen stören.
Hinter der Choreographie erkennt man in Willmann den augenzwinkernden Regisseur, der seine Vorbilder kennt und schätzt. "Das finstere Tal" ist ein dreischichtiges Gewebe aus Western-, Heimat- und Naturroman. Jedes Element wird ein wenig überzeichnet, nur eben so viel, dass man die Idiome erkennt, aber nicht aus der dunkel gespannten Atmosphäre herausgeworfen wird. Willmann arbeitet mit Rückblenden, um die Verbindung Greiders zum Dorf zu erklären. Tatsächlich erweist dieser sich als Träger einer Bürde - Retter und Rächer in einer Person.
Wie vor langer Zeit Hans Lebert in seinem Roman "Die Wolfshaut" (1960), wie Gert Loschütz wieder ganz anders in "Die Bedrohung" (2006), auch wie Andrea Maria Schenkel zuletzt in "Tannöd" (2006), setzt "Das finstere Tal" auf die Bannkraft archaischer, eingewachsener Strukturen. Wie dort entfacht, wer daran rüttelt, schließlich einen gewaltigen Steinschlag.
Willmann leitet die davon ausgehenden Wogen in ein furioses Endszenario. Dazwischen schiebt er mit Lust sentimentale Hochzeitsvorbereitungen oder die dominante Predigt des Dorfpfarrers, vor dem die Gemeinde resigniert duckt. Thema: das Recht der ersten Nacht. Die schlichte Idylle zerfällt angesichts immer tieferer Einblicke in kollektiv gebilligte Brutalität. Willmann erzählt, wie erst der Blick von außen die nicht komplett vereinnahmte Sicht handlungsfähig macht.
Und während sich so der Pfad durch diesen Roman lichtet, erhält der Genremix sein Recht. Willmann spielt mit klassischen Heimat- und Westernbildern - und richtet sie dann gegen sich selbst. Diese Alpengeschichte lebt von der Stilisierung ihrer Figuren, von einem Hauch Ironie, ohne komödiantisch zu werden. Was vielleicht das Faszinierendste ist: Sie beantwortet den Heimatmythos ihrerseits mit einem Mythos, der sich vom Größenwahn seines Helden nährt. Das ist durchaus tollkühn und bewusst überhöht erzählt. Manchmal entgleitet dem Autor etwas die Rhetorik, und er wagt erzählerisch ein paar Umdrehungen (Adjektivgeröll!) zu viel. Insgesamt aber hat er seine Geschichte so gut im Griff wie Howard Hawks einen Western.
ANJA HIRSCH
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Alle Achtung, meint Anja Hirsch: Landschaft und Personen so "cinemaskopisch" in Szene setzen, das kann sonst nur Howard Hawks. Thomas Willmanns Debüt merkt sie also durchaus an, dass der Autor eigentlich Kulturjournalist mit einem Faible für Kino und Western ist. Er erzählt die Geschichte eines Alpendorfs, in das ein Maler, der berühmte Fremder also, einbricht und das bis dahin herrschende Gefüge aus Macht, Gewalt und archaischen Strukturen durcheinander bringt. Ziemlich gut gefällt ihr, wie Willmann seine Helden vor einer gigantischen Kulisse inszeniert, sie stilisiert, immer mit einem Hauch Ironie, ohne die Geschichte aber jemals ins Klamaukige kippen zu lassen. "Tollkühn" sei das, und eine ganz neue Verbindung von Western und Heimatroman.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH