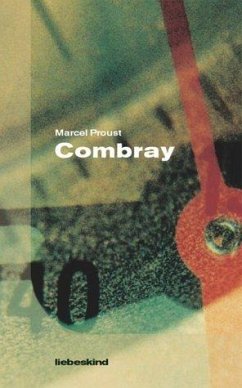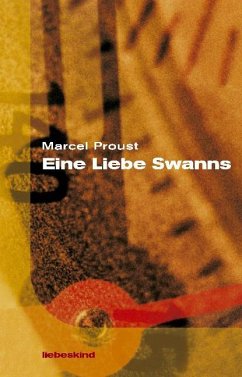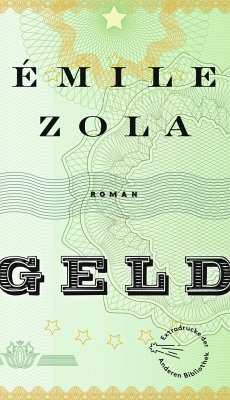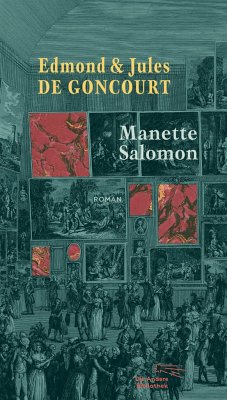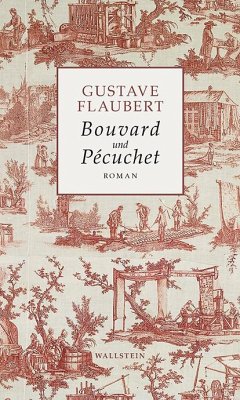Das Flimmern des Herzens
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit - in der Urfassung
Mitarbeit: Vogler, Jonas;Übersetzung: Zweifel, Stefan
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
42,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Anfang April 1913 erhielt Proust die ersten Druckbogen seines monumentalen Romans, der damals noch den Titel trug: »Flimmern des Herzens« (»Les Intermittences du Coeur«). Drei Verlage hatten das Buch abgelehnt - bis Bernard Grasset es schließlich in seinem noch unbekannten Verlag veröffentlichen wollte. Die Genfer Stiftung Bodmeriana beherbergt mit den Korrekturbögen der ersten Fassung eines der großen Rätsel der Literaturgeschichte: Statt bloß letzte Anpassungen vorzunehmen und Fehler zu beseitigen, entwarf Proust mitten auf den Druckfahnen handschriftlich ein neues Buch. Aus der »...
Anfang April 1913 erhielt Proust die ersten Druckbogen seines monumentalen Romans, der damals noch den Titel trug: »Flimmern des Herzens« (»Les Intermittences du Coeur«). Drei Verlage hatten das Buch abgelehnt - bis Bernard Grasset es schließlich in seinem noch unbekannten Verlag veröffentlichen wollte. Die Genfer Stiftung Bodmeriana beherbergt mit den Korrekturbögen der ersten Fassung eines der großen Rätsel der Literaturgeschichte: Statt bloß letzte Anpassungen vorzunehmen und Fehler zu beseitigen, entwarf Proust mitten auf den Druckfahnen handschriftlich ein neues Buch. Aus der »Verlorenen Zeit« wurde Auf der Seite von Swann, aus dem »Flimmern des Herzens« die Suche nach der verlorenen Zeit - nun kann man die verschollene Version zum ersten Mal in deutscher Übersetzung lesen und die Verwandlung in das Jahrhundertwerk Seite für Seite mitverfolgen. Die vorliegende Neuübersetzung des mehrfach ausgezeichneten Übersetzers Stefan Zweifel stellt die beiden Versionen des Romans gegenüber: Die Druckfahnen von 1913 und die endgültige Fassung unter dem Titel: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Damals entwickelte Proust seine literarische Methode, sein Buch auf Grundlage der Druckfahnen ganz neu zu komponieren. Der vorliegende Band präsentiert auf spektakuläre Weise die Keimzelle seines Denkens und Schreibens: Das mit Lindenblütentee getränkte Gebäck Madeleine, aus der seine Kindheitserinnerungen aufsteigen, die sadistischen Rituale von Mlle de Vinteuil, die mit ihrer Geliebten das Porträt ihres toten Vaters entweiht, das endlose Ringen um einen Gutenachtkuss von Maman, die erste Liebe zu einem Mädchen zwischen Weißdornhecken und die an Claude Monet geschulte Beschreibung der Flusslandschaft von Combray.














sv_optimiert.jpg)