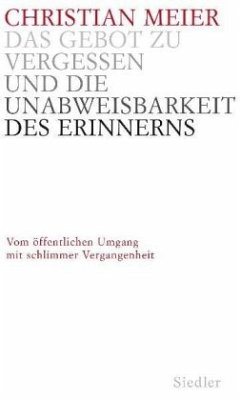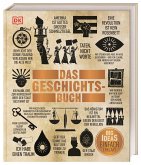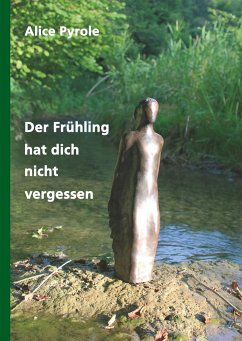Vom Nutzen und Nachteil des Vergessens
Ein zentraler Glaubenssatz unserer Zeit lautet: Um eine Vergangenheit zu "bewältigen", muß man die Erinnerung an sie ständig wachhalten. Christian Meier, einer der bedeutendsten deutschen Historiker, stellt diese Geschichtsversessenheit in seinem brillanten Essay in Frage. Er weist nach, daß in früheren Zeiten nicht Erinnern, sondern Vergessen das Heilmittel war, mit einer schlimmen Vergangenheit fertigzuwerden.
Christian Meier ist die Weltgeschichte durchgegangen, um herauszufinden, was die Menschen früher taten, wenn sie nach Kriegen oder Bürgerkriegen Versöhnung suchten. Sein Befund ist ebenso erstaunlich wie einfach: Die Welt setzte seit den alten Griechen auf Vergessen.
Die deutschen Verbrechen der NS-Zeit aber konnten nicht vergessen werden. Die öffentliche Erinnerung an sie war und ist unabweisbar. Und bei allem Ungenügen: Die Auseinandersetzung damit hat sich gelohnt. Gilt also seitdem eine neue Regel? Wie ist etwa mit der Erinnerung an das Unrecht später gestürzter Diktaturen, zumal des SEDRegimes, umzugehen? Wäre vielleicht auch heute Vergessen eher angebracht als Erinnerung?
Ein zentraler Glaubenssatz unserer Zeit lautet: Um eine Vergangenheit zu "bewältigen", muß man die Erinnerung an sie ständig wachhalten. Christian Meier, einer der bedeutendsten deutschen Historiker, stellt diese Geschichtsversessenheit in seinem brillanten Essay in Frage. Er weist nach, daß in früheren Zeiten nicht Erinnern, sondern Vergessen das Heilmittel war, mit einer schlimmen Vergangenheit fertigzuwerden.
Christian Meier ist die Weltgeschichte durchgegangen, um herauszufinden, was die Menschen früher taten, wenn sie nach Kriegen oder Bürgerkriegen Versöhnung suchten. Sein Befund ist ebenso erstaunlich wie einfach: Die Welt setzte seit den alten Griechen auf Vergessen.
Die deutschen Verbrechen der NS-Zeit aber konnten nicht vergessen werden. Die öffentliche Erinnerung an sie war und ist unabweisbar. Und bei allem Ungenügen: Die Auseinandersetzung damit hat sich gelohnt. Gilt also seitdem eine neue Regel? Wie ist etwa mit der Erinnerung an das Unrecht später gestürzter Diktaturen, zumal des SEDRegimes, umzugehen? Wäre vielleicht auch heute Vergessen eher angebracht als Erinnerung?

Die Massenvernichtung der europäischen Juden ist ein historisch einmaliger Vorgang. Aber Massenmorde und Massaker in kleinerem, sozusagen geschichtsüblichem Maßstab sind seither wieder in großer Zahl verübt worden, selbst in Europa. Die meisten dieser Menschheitsverbrechen ereigneten sich in Bürgerkriegen. Sie waren Ausdruck der Entzweiung und verstärkten diese zugleich, zementierten sie in den Herzen der überlebenden Opfer. Gegen den fortgesetzten Bürgerkrieg hilft nur Versöhnung, oft auch Vergessen. Aber sind das nicht auch Vokabeln einer Schlussstrich-Mentalität, die gerade in Deutschland zu Recht verpönt und geächtet ist?
Christian Meier stellt in seinem Essayband "Das Gebot zu vergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns" (Siedler Verlag, Berlin 2010, 159 S., geb., 14,95 [Euro]) den deutschen Umgang mit dem Holocaust der langen geschichtlichen Tradition von Amnestien und kollektiven Schuldtilgungen gegenüber. Den Hintergrund des Hauptessays, der auf einer Berliner Akademievorlesung von 1996 basiert, bildet eine Frage, die den Historiker und Zeitzeugen Meier seit Jahrzehnten umtreibt: Wie lässt sich Auschwitz in die große Erzählung der Geschichtswissenschaft einfügen, ohne dass es sie zerreißt? Im nachgeholten Gedenken, so die im Stillen dabei anklingende Hoffnung, fände die Nation einen Weg, sich selbst die Wahrheit über die Vernichtungslager zu erzählen. Der neue Band deutet an, dass diese Hoffnung sich erfüllt hat.
Bei den Athenern des Jahres 403 vor Christus, zeigt Meier, ging die erste allgemeine Amnestie der Geschichte aus der Notwendigkeit hervor, den Kreislauf von Rache und Widerrache, der ihren Staat zu zerstören drohte, zu durchbrechen. Die Cäsar-Mörder des Jahres 44 vor Christus und die Friedensvertragspartner der europäischen Neuzeit beschworen kollektives Vergessen als Heilmittel gegen das Wiederausbrechen des Krieges. Erst im Vertrag von Versailles 1919 wurde der Grundsatz der "strafenden Gerechtigkeit" über den der Versöhnung gestellt, mit den bekannten Folgen.
Das Besondere der geschichtlichen Situation nach 1945 besteht für Meier nun darin, dass sowohl die Deutschen als auch die alliierten Siegermächte mehr als zehn Jahre brauchten, um zu begreifen, dass die gewohnten Mechanismen von Strafe und Exkulpation diesmal nicht griffen. Erst mit den Ulmer Einsatzgruppenprozessen des Jahres 1958 drehte sich der Wind vom "Schlussstrich" zur "Aufarbeitung" der Vergangenheit. Ebendieses verlorene Jahrzehnt ist für Meier der Schlüssel zur späteren erfolgreichen Geschichtspolitik der Bundesrepublik. "Untaten größten Stils", so sein Resümee, seien womöglich "so lange zu beschweigen", bis man "aus ihrem unmittelbaren Schatten heraus" sei.
Auch Nationen, heißt das, handeln nach den Gesetzen der Psychologie. Dass das auch für die sehr verschieden sozialisierten Kollektive der Ost- und der Westdeutschen gilt, die sich 1990 in aller Eile vereinigten, demonstriert der zweite, kleinere Aufsatz dieses Bandes. Auch die deutsche Einheit war ein Ereignis ohne Beispiel, das man mit historischen Bordmitteln zu bewältigen suchte. Das gelang nicht; oder nicht ganz. Aber die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende.
ANDREAS KILB
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Beeindruckt zeigt sich Elisabeth von Thadden von der Fragestellung dieses Buchs, ihren Informationen zufolge eine Komposition aus zwei überarbeiteten Vorträgen des 81-jährigen Historikers. Kann Erinnerung einer Wiederholung des Schlimmen vorbeugen, oder bringe sie mit der Rache nur neues Schlimmes hervor?, fasst die Kritikerin die Fragestellung zusammen. Zu ihrer Beantwortung nehme Christian Meier nicht weniger als zweieinhalb Jahrtausende europäische Geschichte in den Blick, sowie geschichtspolitische Gepflogenheiten der europäischen Kulturen. Herausgearbeitet werde besonders der Zivilisationsbruch, den das Wort "Auschwitz" markiert, und von zwei Modellen ausgehend diskutiere Meier tragfähige Konzepte für eine Gedächtniskultur: dem Modell Ciceros, der für Amnestie zugunsten des gesellschaftlichen Friedens plädierte, und dem Richard von Weizsäckers, der Erinnern als Kur gegen neuerliche Ansteckungsgefahr empfahl. Meiers Argumentation nun besticht die Kritikerin, weil er jenseits von Erinnern und Vergessen sich für ein Maß stark macht, dass die Geschichtspolitik jeweils am Einzelfall orientieren will, und die jeweilige Berücksichtigung der Schwere historischer Vergehen empfiehlt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH