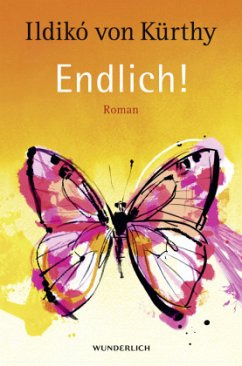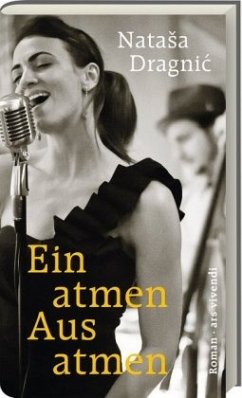Nicht lieferbar

Das Gedächtnis der Libellen
Roman. Ausgezeichnet mit dem Preis der LiteraTour Nord 2013
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Die Geschichte einer unmöglichen LiebeMit bewundernswerter Konsequenz erzählt Marica Bodrozic von einer ebenso unbedingten wie widersprüchlichen Liebe. Und von einer Frau, die Abschied nehmen muss von ihren Illusionen über ihre Beziehung zu einem verheirateten Mann. Und die sich fragen muss, wer sie am Ende ohne ihre Liebe ist.Noch sind die Tage ungetrübt. Die junge Nadeshda fährt nach Amsterdam, um dort ihren Geliebten Ilja zu treffen. Sie hat Schuhe mit den höchsten Absätzen an und phantasiert sich Iljas Küssen entgegen. Doch was als lustvolle Reise beginnt, wirft Nadeshda völlig a...
Die Geschichte einer unmöglichen Liebe
Mit bewundernswerter Konsequenz erzählt Marica Bodrozic von einer ebenso unbedingten wie widersprüchlichen Liebe. Und von einer Frau, die Abschied nehmen muss von ihren Illusionen über ihre Beziehung zu einem verheirateten Mann. Und die sich fragen muss, wer sie am Ende ohne ihre Liebe ist.
Noch sind die Tage ungetrübt. Die junge Nadeshda fährt nach Amsterdam, um dort ihren Geliebten Ilja zu treffen. Sie hat Schuhe mit den höchsten Absätzen an und phantasiert sich Iljas Küssen entgegen. Doch was als lustvolle Reise beginnt, wirft Nadeshda völlig aus dem Gleichgewicht, bringt sie an ihre Grenzen und verändert ihre ganze Wahrnehmung von ihrer Liebe und sich selbst. Denn Nadeshda muss erkennen, dass sie in ihre Träume, Sehnsüchte und merkwürdig robusten Hoffnungen verstrickt ist, obwohl sie es besser hätte wissen können. Obwohl sie hätte sehen müssen, dass ihr Wunsch, den verheirateten Ilja ganz für sich zu gewinnen, nie in Erfüllung gehen wird. Denn Ilja hat sie nie hinters Licht geführt: Von der ersten Begegnung an sprach er davon, dass ihre Liebe keine Zukunft haben könne. Das hindert ihn aber keineswegs daran, Nadeshda dennoch weiterhin seine Liebe zu erklären.
Marica Bodrozic hat den Roman einer ebenso unbedingten wie ausweglosen Liebe geschrieben. Einen Roman, der zugleich die Geschichte eines beispiellosen Verlusts erzählt. Denn Nadeshda muss am Ende nicht nur Abschied nehmen von dem Mann, den sie, das hatte sie sich geschworen, nie aufgeben würde. Sie muss vor allen Dingen auch Abschied nehmen von sich als der Liebenden dieses Mannes. Es ist ein Abschied, der sie zurückführt auf sich selbst, auf ihre Vergangenheit und den Libellen sammelnden Vater. Und all diese Abschiede wiegen deshalb so schwer, weil Nadeshda nicht absehen kann, wer sie ohne ihre Liebe ist.
Mit bewundernswerter Konsequenz erzählt Marica Bodrozic von einer ebenso unbedingten wie widersprüchlichen Liebe. Und von einer Frau, die Abschied nehmen muss von ihren Illusionen über ihre Beziehung zu einem verheirateten Mann. Und die sich fragen muss, wer sie am Ende ohne ihre Liebe ist.
Noch sind die Tage ungetrübt. Die junge Nadeshda fährt nach Amsterdam, um dort ihren Geliebten Ilja zu treffen. Sie hat Schuhe mit den höchsten Absätzen an und phantasiert sich Iljas Küssen entgegen. Doch was als lustvolle Reise beginnt, wirft Nadeshda völlig aus dem Gleichgewicht, bringt sie an ihre Grenzen und verändert ihre ganze Wahrnehmung von ihrer Liebe und sich selbst. Denn Nadeshda muss erkennen, dass sie in ihre Träume, Sehnsüchte und merkwürdig robusten Hoffnungen verstrickt ist, obwohl sie es besser hätte wissen können. Obwohl sie hätte sehen müssen, dass ihr Wunsch, den verheirateten Ilja ganz für sich zu gewinnen, nie in Erfüllung gehen wird. Denn Ilja hat sie nie hinters Licht geführt: Von der ersten Begegnung an sprach er davon, dass ihre Liebe keine Zukunft haben könne. Das hindert ihn aber keineswegs daran, Nadeshda dennoch weiterhin seine Liebe zu erklären.
Marica Bodrozic hat den Roman einer ebenso unbedingten wie ausweglosen Liebe geschrieben. Einen Roman, der zugleich die Geschichte eines beispiellosen Verlusts erzählt. Denn Nadeshda muss am Ende nicht nur Abschied nehmen von dem Mann, den sie, das hatte sie sich geschworen, nie aufgeben würde. Sie muss vor allen Dingen auch Abschied nehmen von sich als der Liebenden dieses Mannes. Es ist ein Abschied, der sie zurückführt auf sich selbst, auf ihre Vergangenheit und den Libellen sammelnden Vater. Und all diese Abschiede wiegen deshalb so schwer, weil Nadeshda nicht absehen kann, wer sie ohne ihre Liebe ist.