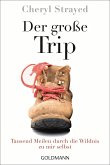Eine Literaturstudentin stirbt mit 22 Jahren bei einem Autounfall.
Und hinterlässt der Welt ungeheure Stories, die Millionen Menschen in hundert Ländern mitreißen. Eine Internetsensation: 2,1 Millionen Klicks, monatelang auf der New York Times Bestsellerliste!
Nur wenige Tage nach ihrem Yale-Abschluss stirbt die 22jährige Marina Keegan bei einem Autounfall. Und hinterlässt der Welt brillante Stories voller Lebenslust. 'Das Gegenteil von Einsamkeit' bewegt Millionen Menschen in hundert Ländern.
Marina Keegan war ein Ausnahmetalent. Sie vereint schwerelosen, sensiblen Optimismus mit literarischer Reife. Die Stories sind klangvoll, witzig und doch gebrochen, manchmal wild und angriffslustig; sie sind ein stürmisches Plädoyer für die Jugend, die Lebensfreude, begeistern durch ihre Hoffnung und Entschiedenheit: Lasst euch nicht gleich von McKinsey anheuern, findet eure Bestimmung, habt Vertrauen in eure Zukunft! Eine flammende Aufforderung, die eigene Jugend und den Sinn des Lebens (wieder) zu entdecken.
Und hinterlässt der Welt ungeheure Stories, die Millionen Menschen in hundert Ländern mitreißen. Eine Internetsensation: 2,1 Millionen Klicks, monatelang auf der New York Times Bestsellerliste!
Nur wenige Tage nach ihrem Yale-Abschluss stirbt die 22jährige Marina Keegan bei einem Autounfall. Und hinterlässt der Welt brillante Stories voller Lebenslust. 'Das Gegenteil von Einsamkeit' bewegt Millionen Menschen in hundert Ländern.
Marina Keegan war ein Ausnahmetalent. Sie vereint schwerelosen, sensiblen Optimismus mit literarischer Reife. Die Stories sind klangvoll, witzig und doch gebrochen, manchmal wild und angriffslustig; sie sind ein stürmisches Plädoyer für die Jugend, die Lebensfreude, begeistern durch ihre Hoffnung und Entschiedenheit: Lasst euch nicht gleich von McKinsey anheuern, findet eure Bestimmung, habt Vertrauen in eure Zukunft! Eine flammende Aufforderung, die eigene Jugend und den Sinn des Lebens (wieder) zu entdecken.

Die postum veröffentlichten Erzählungen der frühverstorbenen Marina Keegan erforschen das "Gegenteil von Einsamkeit". Was die Autorin auszeichnet, ist ihr durchdringender Blick auf Alltägliches.
Ihr bestürzend kurzes Leben gäbe selbst den wirkungsträchtigen Hintergrund für eine Erzählung ab. Marina Keegan, Jahrgang 1989, ist engagierte Yale-Absolventin, schreibt Essays und Erzählungen, macht ein Praktikum bei der "Paris Review", nach dem Examen bekommt sie einen Job beim "New Yorker". Auf einer Autofahrt zum Ferienhaus ihrer Eltern im Frühjahr 2012 - es ist weder Nacht noch Unwetter, noch hat der Fahrer Alkohol getrunken - überschlägt sich der Wagen, nachdem der Freund am Steuer eingeschlafen ist. Die Zweiundzwanzigjährige stirbt, der Freund bleibt unverletzt. Der Tragik, die der so frühe Tod eines Menschen mit sich bringt, kann allzu leicht noch eine zweite, wenngleich andersgeartete folgen. Wenn, wie im Falle von Marina Keegans nun postum erschienener Erzählungs- und Essaysammlung "Das Gegenteil von Einsamkeit", auch nur der leiseste Verdacht in der Luft zu liegen scheint, dass ein Unglück in verlegerisches Kapital umgemünzt werden könnte.
Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen hat die Sammlung Anne Fadiman, Keegans Dozentin in Yale, die bei allem Bemühen um eine gewisse Mäßigung doch nicht umhinkommt, ihre Emphase für die unersättliche Lebens- und Schreibenergie ihrer ehemaligen Studentin zum Ausdruck zu bringen, nicht zu vergessen für deren Talent.
Viel Vorschusslorbeer mithin, der die erste Erzählung in dem Band nicht wirklich gerecht werden mag. "Kalte Idylle" kommt als College-Lovestory daher, in der eine frische und relativ uninspiriert geführte Beziehung erst durch den überraschenden Tod des Jungen von ihrem Auf-der-Stelle-Treten erlöst wird. Sicherlich, eine gewisse hintersinnige Distanz zum eigenen Taktieren in Liebesdingen und zur Fadenscheinigkeit des eigenen Selbstbewusstseins mag diese Geschichte enthalten. Aber viel mehr doch nicht. Das Sterben des Freundes erscheint allenfalls durch sein Korrespondieren mit dem Schicksal von Keegan selbst im Nachhinein ein gewisses Unbehagen zu verursachen.
Am Ende der Lektüre bleibt so die leicht schale, wenn auch nicht sonderlich überraschende Ahnung, dass man es hier eben mit den ersten Schreibversuchen einer zweifelsohne nicht unbegabten gerade Zwanzigjährigen zu tun hat. Was nicht verwerflich wäre, aber eben auch nicht sonderlich sensationell ist. Allerdings: Es handelt sich nur um die erste von neun Erzählungen. Bereits nach der zweiten Erzählung, "Winterferien", auch wenn sie in einem ähnlichen Milieu spielt, ist diese schale Ahnung verflogen. Wenn Marina Keegan über den Besuch einer Studentin bei ihren Eltern und dem jüngeren Bruder während der Semesterferien erzählt, dann könnte man nur dem ersten Anschein nach meinen, man habe es mit der üblichen Schilderung der Mixtur aus einer gar nicht so unangenehmen Langeweile, familiären Verpflichtungen und den befreienden Ausflügen ins Bett des Freundes zu tun. Was Keegan tatsächlich gelingt, beinahe beiläufig, aber mit einem ebenso feinen Gespür für Stimmungen und Situationen und zugleich mit einem liebevollen Respekt für die Figuren, ist, ein Bild umfassender und prosaischer, deshalb aber umso traurigerer Einsamkeit zu zeichnen. Der beständig vor Computerspielen hockende Bruder, der trinkende Vater sind nur Randfiguren. Fragile Heldin dieser Erzählung ist die Mutter, die tapfer und beherrscht, aber doch unendlich verlassen Tag für Tag im Wäschekeller ihres Hauses in der amerikanischen Provinz steht und Socken sortiert.
"Das Gegenteil von Einsamkeit" heißt nicht erst Keegans Buch, auch ihre Rede auf der Abschlussfeier von Yale trug diesen Titel. "Wir haben kein Wort für das Gegenteil von Einsamkeit, aber wenn es eins gäbe, könnte ich sagen, genau das will ich im Leben." So lautet der erste Satz von Keegans Rede, die alles andere als eine euphorische Selbstversicherung ist, eher handelt es sich um die Formulierung einer unbedingten Hoffnung. Beinahe um eine Beschwörung.
Wenn man Keegans Erzählungen liest, dann scheinen die Figuren allesamt vom Empfinden einer existentiellen Verlassenheit grundiert zu sein, gerade auch dort, wo sie in nach außen hin passabel wirkenden Beziehungen oder Freundeskreisen aufgehoben sind. Mitunter versuchen sich Keegans Figuren in ihren biographisch unumkehrbaren Situationen einzurichten: wie die Mutter der Studentin oder aber, in einer anderen Erzählung, eine Frau knapp jenseits der vierzig, die ein Baby adoptiert, nachdem sie sich hat eingestehen müssen, dass die Zeit vorbei ist, selbst eines zu bekommen, und auch der Glaube an eine funktionierende Beziehung sich verflüchtigt hat. Promptes Glück beschert das Kind freilich nicht, sondern die bittere Erkenntnis, wie fremd dieser neue Mensch ist.
Wie Marina Keegan - und an dieser Stelle muss dann doch noch mal ihr Alter ins Feld geführt werden - mit einer überraschenden Lebensklugheit und einer ebenso eindringlichen wie unaufdringlichen Sprache das Verwelken von Hoffnungen beschreibt genauso wie den Versuch des Sich-Einrichtens in den Verhältnissen, die einem vielleicht nicht das Schicksal, sondern nur die eigene Selbstvergessenheit auferlegt hat, das ist ebenso erstaunlich wie berührend.
Einer gekonnten Dramaturgie folgt in dieser Hinsicht der Aufbau des Buches. Von der Oberfläche - der College-Lovestory - dringt Keegan von Erzählung zu Erzählung immer mehr in das Seelenleben nicht nur ihrer Generation, sondern in die Unbehaustheit ihrer Zeit, betreibt Tiefenbohrungen im menschlichen Bewusstsein. Nur konsequent, dass die letzte Erzählung eine umfassende, albtraumgleiche und beinahe allegorische Isolation entwirft: ein U-Boot, dessen Apparate versagt haben und das nun mit seiner Besatzung, ohne Kontakt zur Welt, in den dunklen Tiefen des Ozeans treibt. Ein paar Quallen, die vorbeischweben, sind die letzte verbleibende Sensation.
Still, unaufgeregt und bezwingend erzählt Keegan von dieser Untersee-Blase, in der kein Ausweg bleibt aus Stillstand und lähmendem Fatalismus. Für das Denken von Marina Keegan aber gilt das Gegenteil. Die Essays, die in "Das Gegenteil von Einsamkeit" versammelt sind, zeigen nicht nur ihre Lust an der Beobachtung, sondern ihren nie angestrengten, aber durchdringenden Blick auf vermeintlich banale Alltäglichkeiten - die wohligen Routinen etwa, die man im ersten eigenen Auto zelebriert - wie auch auf die großen Fragen, wie die nach der menschlichen Barmherzigkeit. Bei allem Unglück der Umstände kann man sich ein schöneres Vermächtnis als dieses Buch kaum ausdenken.
WIEBKE POROMBKA
Marina Keegan: "Das Gegenteil von Einsamkeit". Stories und Essays.
Aus dem Amerikanischen von Brigitte Jakobeit. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2015. 288 S., geb. 18,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension
Die Vermarktung von Marina Keegans "Das Gegenteil von Einsamkeit" fasst Rezensentin Ronja Larissa von Rönne so zusammen: die Autorin ist "sehr jung, sehr hoffnungsvoll und sehr, sehr tot", was die Rezensentin reichlich makaber findet und ihr Bilder eingibt, wie die Verleger Keegans Tod mit einer "kleinen Party zur Rettung der Gutenberg-Galaxis" begehen. Von Rönne rät also davon ab, das Buch zu kaufen - lesen sollte man es dabei eigentlich auf jeden Fall, fügt die Rezensentin hin und her gerissen hinzu, denn es sei tatsächlich ein wunderbarer Versuch einer Autorin, die noch nicht so recht wusste, wohin mit ihrem Schreibtalent, die aber schöne, pathosfreie Geschichten über Zwischenmenschliches unter Extrembedingungen erzählen konnte, fasst von Rönne zusammen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
witzig, weise, emphatisch und im besten Sinne idealistisch. [...] Ihre Erzählungen erinnern an Alice Munro, der Ton setzt sich einem im Kopf fest Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 20150329