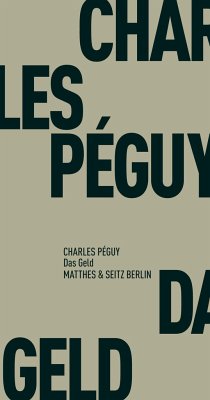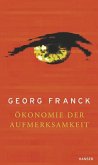»Die Welt hat sich seit Jesus Christus weniger verändert als in den letzten dreißig Jahren«, musste Charles Péguy 1913 mit Schaudern feststellen. Gegen die kalte Rationalisierung und Ökonomisierung des Lebens im Zuge der Umwälzungen der Moderne verfasste er mit Das Geld eine ergreifende Ode an das verschwindende alte, volksnahe Frankreich, das über Jahrhunderte Bestand hatte. Er beschreibt das einfache, aber satte Leben zwischen Kirche und Dorfschule, das sich durch eine ganz eigene Würde jenseits des Glanzes des Überflusses auszeichnete. Und er schildert, wie die Beziehungen gegenseitiger Anerkennung bis in die Elementarschule Geltung hatten, eine Institution, die wie keine für die Überlieferung und Verankerung von Wissen und Werten stand und ebenfalls zu erodieren drohte. Péguys Schilderungen zwischen Nostalgie und Empörung berühren uns noch heute, sind sie doch von bleibender Aktualität.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Zwei Bücher von und über Charles Péguy laden ein, einen großen Zeitkritiker kennenzulernen
Joseph Hanimanns Buch erscheint in einem historischen Augenblick, wo das in Deutschland nahezu vergessene Denken Charles Péguys (1873-1914) eine erstaunliche Aktualität entfaltet. Die Reaktionen auf den hundertsten Todestag im Jahr 2014 haben sichtbar gemacht, dass dieser verbissene Einzelkämpfer von den denkbar verschiedensten politischen Positionen reklamiert werden konnte: Bruno Latour sah in ihm einen kritischen Propheten der Globalisierung, Alain Finkielkraut einen Garanten der kulturellen Identität Frankreichs, der Zentrumspolitiker François Bayrou den Herold christlich-humanistischer Tradition in der Politik, der linke Journalist Edwy Plenel den Zeugen einer unbeirrbaren Suche nach der Wahrheit.
Um die einzigartige Position Péguys im literarischen und politischen Leben Frankreichs herauszuarbeiten, greift Hanimann zu einem Vergleich mit Karl Kraus. Nicht nur führen sie ihre Zeitschriften, "Die Fackel" (1899-1936) und "Les Cahiers de la Quinzaine" (1900-1914), auf ähnliche Weise: Beide verzichten auf jede Form von Reklame, beide stoßen nach und nach ihre oft berühmten Mitarbeiter (etwa Heinrich Mann und Romain Rolland) ab, beide sind schließlich Verleger, Chefredakteur und einziger Autor in einer Person. Es eint sie auch ein Kampf gegen die Moderne, der sie doch selbst angehören.
Im Zentrum steht die Ablehnung des alles einebnenden Kapitalismus und die Kritik der modernen Presse, als deren Antipoden sie ihre "Gegenzeitungen" redigieren. Doch sind auch die Unterschiede zwischen ihnen so gravierend, dass Hanimann im Verlauf seiner Darstellung die Parallelisierung mehr oder weniger fallenlässt. Das gilt ganz besonders für die Konversion der beiden Autoren zum Katholizismus: Für Kraus war das ein rein privater Akt, der der Öffentlichkeit verborgen blieb, während sich Péguy in einen miles Christi verwandelte.
Kraus und Péguy haben einander nie kennengelernt, doch haben sich ihre Zeitschriften einmal an einem neuralgischen Punkt berührt: der Dreyfus-Affäre. In dieser Sache scheint ihr Gegensatz unversöhnlich. Für Péguy, den jungen Sozialisten, war sie eine Initialzündung, an der er später alles maß. Der Kampf um die Wahrheit, die bedingungslose Verteidigung eines Unschuldigen, war für ihn die Erfüllung der "sozialistischen Mystik" jenseits aller Politik. Sobald seine sozialistischen Mitstreiter (Blum, Jaurès) zu bloßen Parteipolitikern der verachteten parlamentarischen Demokratie wurden, sobald Dreyfus zur politischen Marke gemacht wurde, wandte er sich angeekelt ab und zögerte nicht, seine ehemaligen Freunde auf dieselbe Ebene zu stellen wie seine deklarierten Gegner, etwa die "Action française" des katholischen Nationalisten Charles Maurras. Kraus hatte in der "Fackel" in Sachen Dreyfus Wilhelm Liebknecht das Wort gegeben, der an der Unschuld von Dreyfus zweifelte. Péguy bezieht sich ablehnend auf diesen Text, der bei Teilen der französischen Linken Beifall gefunden hatte. Kraus sah die "Affäre" unter dem Gesichtspunkt seines Wiener Antizionismus. Immerhin kommentierte er: "Nur in Frankreich vermochte der Schrei eines Verurtheilten durchzudringen, ohne erstickt zu werden." Dank Männern wie Péguy.
Um Péguys Radikalität zu begreifen, muss man sein philosophisches Credo erläutern. Als enthusiastischer Schüler Bergsons hatte er für sich eine Metaphysik der Zeit entwickelt, die mit dem Begriff des "Fortschritts" unvereinbar war. Es gab für ihn einen aus der Antike, dem Judentum und dem christlichen Mittelalter herrührenden Sockel, der sich dem historischen Zeitablauf entzog. Entschiedener Feind der szientistischen Historiker der Sorbonne, führte er einen persönlichen Dialog mit Clio, der Muse der Geschichte. Hanimann sieht zu Recht in Péguys Einstellung zur Geschichte eine Parallele zum Konzept der nationalen Erinnerungsorte und ihrer Wirkmächtigkeit.
Péguys geheiligte "lieux de mémoire" waren Jeanne d'Arc und die Kathedrale Notre-Dame de Chartres. Er konzentrierte seine Feindseligkeit gegenüber der "Moderne" und ihren intellektuellen Proponenten auf den Gegensatz von "Mystik und Politik". Zolas und sein Kampf für den Hauptmann Dreyfus waren ein purer "mystischer" Moment jenseits der Politik gewesen. Durch die parlamentarische Politik verloren rechts (die Metaphysik der Priester) und links (die Metaphysik des Fortschritts, inkarniert von den Volksschullehrern, den "schwarzen Husaren der Republik"), ihre "mystische" Verankerung im "Volk". Dieses "Volk" wird durch seine modernen Führer korrumpiert: Der absolut gesetzte Wert der guten Handarbeit, in dem sich die Erbauer der Kathedralen mit den Handwerkern treffen, wird durch die Gewerkschaften und ihre Forderungen nach der Verbesserung der Lebensbedingungen zerstört.
Nach seiner (Re)konversion zum Katholizismus 1908 attackierte Péguy wütend das Auseinanderreißen der zwei "Metaphysiken" seiner Kindheit, die in seinen Augen trotz aller Gegensätze im "mystischen" Grunde eins waren, nämlich Dienst am "Volk". In diesen Kontext gehört auch seine Verherrlichung der Armut, die in manchem an Rilkes "Buch von der Armut und vom Tode" erinnert. Für Péguy entsprach die Armut dem Evangelium, und er bezichtigte die Amtskirche, aus dem Christentum eine Religion der reichen Bürger gemacht zu haben.
Joseph Hanimann gelingt es, die Vielfalt dieses Denkens und die meist polemischen Auseinandersetzungen mit Zeitgenossen aus Politik, Literatur und Wissenschaft vorzustellen und in ihren historischen, institutionellen und politischen Rahmen einzuordnen. Man bekommt neben der Lebensgeschichte Péguys und seinem intellektuellen Werdegang auch eine kurze, aber präzise Geschichte einer Periode: markiert durch die Einführung der Pflichtschule, die Liberalisierung des Vereins- und Pressewesens und die Trennung von Kirche und Staat.
Péguys Polemiken gelten keinen bloß historischen Positionen: Der Streit um private Schulen ebenso wie um die Definition von Laizität ist heute wieder überaus aktuell, der Begriff des "Volkes" beherrscht den Wahlkampf, der Zweifel am Fortschritt grassiert, der Vorwurf der Verbürgerlichung zersplittert die sozialistische Partei, im entchristlichten Frankreich stehen einander traditioneller bürgerlicher Katholizismus und das Ideal des Franz von Assisi gegenüber, das ökologisch-sozialistische Denken hat keine Scheu mehr, sich auf die päpstliche Enzyklika "Laudato si'" zu berufen, und die Kritik am Finanzkapitalismus lässt die Grenzen von rechts und links verschwimmen. Péguy hat 1913 eine Nummer seiner Zeitschrift "L'argent" betitelt, ein Büchlein, das eben auf Deutsch erschienen ist, eine Art "Konfession", in der alle Paradoxien des Autors versammelt sind. Im Zentrum steht das Geld, das alles austauschbar werden lässt, im Gegensatz zur Arbeit, die vom "Volk" wie ein Gebet verrichtet worden sei.
Der Konvertit Péguy hat auch die Theologen interessiert. Dafür zeugt eindringlich die von Hans Urs von Balthasar zusammengestellte Anthologie "Wir stehen alle an der Front", die 1953 auf Deutsch erschien. 2014 wurden die Originaltexte dieser Auswahl unter dem Titel "Nous sommes tous à la frontière" neu herausgebracht. Péguy, der als glühender Nationalist in den ersten Tagen des Ersten Weltkriegs fiel, wird hier zu einem von der Gnade heimgesuchten Soldaten Christi. Von Balthasar, auf den sich Hanimann ausdrücklich bezieht, ging auch auf Péguys Stil ein, erklärte das dichterische Werk für unübersetzbar und meinte zur Prosa, sie sei "eine Mischung aus lateinischer Form und Abstraktion, volkstümlich, gallisch, farbig, enthusiastisch". Aber er hatte auch gewichtige Einwände, die sich in Kürzungen und Streichungen so mancher der litaneihaften Beschwörungen, zu denen Péguy neigt, niederschlugen. Es ist nicht verwunderlich, dass Marcel Proust mit Péguy wenig anfangen konnte.
Bei der Lektüre der Studie Hanimanns hat der Rezensent nur eines wirklich bedauert: dass der querköpfige "Unzeitgenosse" nicht oft genug zu Wort kommt. Ein Irrtum bleibt zu korrigieren: Kraus' berühmte Rede vom November 1914 gegen den Krieg hieß nicht "In diesen großen Zeiten", sondern "In dieser großen Zeit". Als sie nach langem Schweigen gehalten wurde, war Péguy bereits tot. Er hätte sich wohl mit ihr identifiziert.
GERALD STIEG
Joseph Hanimann: "Der Unzeitgenosse". Charles Péguy - Rebell gegen die Herrschaft des Neuen.
Carl Hanser Verlag, München 2017. 240 S., br., 22,- [Euro].
Charles Péguy: "Das Geld".
Aus dem Französischen und mit einem Vorwort von Alexander Pschera, Nachwort von Peter Trawny. Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2017. 137 S., br., 12,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main