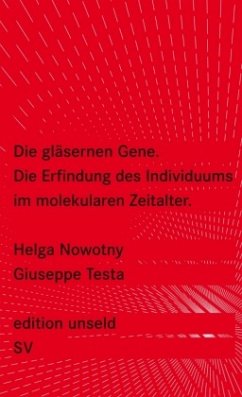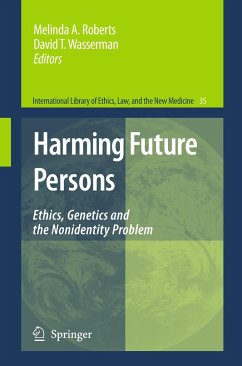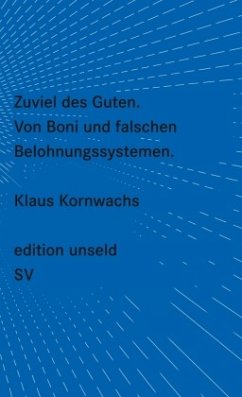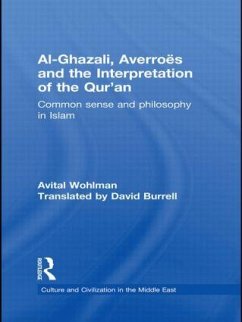Das Gen im Zeitalter der Postgenomik
Eine wissenschaftshistorische Bestandsaufnahme
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
10,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Seine Position als zentrales organisierendes Thema der Biologie des 20. Jahrhunderts verdankt 'das Gen' weniger endgültigen wissenschaftlichen Befunden als vielmehr der Tatsache, daß der ihm entsprechende Forschungsgegenstand, sein 'epistemisches Objekt' also, sich Zug um Zug instrumentell vermittelter, experimenteller Handhabung erschloß.Mit der Komplettierung der Sequenzen ganzer Genome, insbesondere des Humangenoms, ist die Genetik - als Wissenschaft ein Kind des 20. Jahrhunderts - erneut an den Rand eines grundlegenden Denkwandels getreten. Vielfach werden Stimmen laut, die den Genbegriff zu Gunsten systemischer Perspektiven in Frage stellen oder gar ganz aufgeben wollen. Auf der anderen Seite treten überwunden geglaubte Denkfiguren wie die Vererbung erworbener Eigenschaften oder die Einteilung des Menschen nach 'Rassen' wieder in das Blickfeld wissenschaftlicher und medizinischer Debatten. Um den Gegenwartshorizont des Genetischen angesichts dieser verwirrenden Situation abzustecken, ist eine historische Standortbestimmung angebracht. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass 'das Gen' das zentrale organisierende Thema der Biologie des 20. Jahrhunderts war. Ein Blick auf die Geschichte der Genetik und Molekularbiologie zeigt jedoch, dass es nie eine allseits akzeptierte Definition des Gens gegeben hat. Vielmehr befand sich der Begriff, und dies ist keineswegs untypisch für historisch einflußreiche wissenschaftliche Begriffe, immer im Fluß.