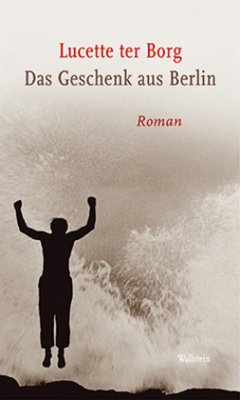»Ein reisendes Familienorchester, ein Bechstein als Geschenk vom Führer und die Liebe zu Beethoven in der kanadischen Wildnis - eine wahre Familiengeschichte einer »Erzählerin der Spitzenklasse«.«(Nederlands Dagblad)Sechsundsiebzig Jahre ist der Gutsverwalter Andreas Landewee alt, als er sich entschließt, Deutschland zu verlassen, um in der kanadischen Wildnis von Britisch Kolumbien mit seinem Sohn Wolfgang ein neues Leben zu beginnen.Nur die allerwichtigsten Dinge nimmt er mit: ein paar Kleidungsstücke, Bücher, seine Jagdgewehre, die Langspielplatten - und den Bechstein-Flügel seiner verstorbenen Frau, den er hütet wie einen Schatz.Wer ist dieser Mann, der so viel über Bäume und Wälder weiß, sich selbst und seine Kinder jedoch so wenig kennt? Der in Böhmen als Kind reisender Orchestermusiker aufwuchs, nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurde und in Deutschland eine ehemals von Hitler verehrte und protegierte Opernsängerin heiratete? Und der jetzt, in der Stille der kanadischen Wälder, auf dem Geschenk aus Berlin, dem »Flügel vom Führer«, Beethoven und Liszt spielt?Lucette ter Borg erzählt in ihrem Debüt von den Geheimnissen einer Familie, von Verführung und Liebe, den Verlockungen des Selbstbetrugs und vom Zauber der Musik.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Altösterreich an neuen Ufern: Lucette ter Borgs Aussteigerroman
"Er dachte: Ich habe einen Rucksack mit Sachen, das ist genug. Wenn ich nur will, kann ich alles werden. Kein Mensch wird mich hier finden." So viel Gründermut überrascht in diesem Fall - es ist eine etwas andere Aussteigergeschichte, die die Amsterdamerin Lucette ter Borg in ihrem Romandebüt erzählt: Andreas Landewee, der Held, ist immerhin 76, als er seine Zelte in Deutschland abbricht und zu seinem Sohn in die Einsamkeit der Wälder British Columbias zieht. Der alte Mann hat gerade seine zweite Frau verloren, die große Liebe. Sie starb, wie einst seine Mutter, an Krebs. Wie sie war Elisabeth Sängerin, war sogar berühmt. Mit dem anderen Sohn, mit der Tochter verbindet ihn kaum mehr als mit seinem Wohnsitz Rothenburg.
Andreas, Jahrgang 1901, ist so etwas wie ein Doppelfachmann: Mit der Musik beschäftigte er sich zeitlebens aus reiner Neigung, mit der Land- und Forstwirtschaft auch von Profession. Er ist Ästhet und Praktiker, einer, der gerne lebt. Als sein Sohn bei einem Ausflug in Black Creek von ihm wissen will, welches der im Bergsee gespiegelten Bilder ihm besser gefalle, der Hirsch oder die Gipfel, stellt er klar: "Schönheit ist kein Wettkampf. Berge sind schön, aber Musik auch."
Aus einer nordböhmischen Musikerfamilie stammend, erlebte das Kind sich früh als unzulänglich: Der Vater, der mit Frau und Orchester in ganz Europa auf Tournee ging, empfand den Kleinen, der sich einbildete, ausgerechnet in Jekaterinoslaw auf die Welt kommen zu müssen, von Anfang an als Störenfried, hatte später an seinem Klavierspiel immer etwas auszusetzen. Dann, nach einem Rodelunfall gelähmt, muss Andreas mit der Mutter zur Rehabilitation nach Deutschland, liegt monatelang im Gipskorsett, lernt schließlich wieder gehen, das schweißt die beiden zusammen. Er beschließt, groß und stark zu werden, verordnet sich viel Sport, viel Natur. Motor der Selbsterziehung zum Übermenschen ist ein ödipaler Bilderbuchhass auf den Vater, den Gierigen, den Egomanen, der meint, wenn er nur die Musik hat, sehr gut ohne Frauen auskommen zu können (aber nicht ohne Frauen auskommen kann). Dem Sohn geht es darum, "eine höhere Art Mensch zu werden, als was da unten mit vollem Bauch im Sessel hing. Kein Herdentier, kein Hundspöbel, sondern ein freier Geist, ein lachender Sturm. Für sie. Seine Mutter."
Rückblenden wie diese baut Lucette ter Borg geschickt in die Gegenwartsebene der Handlung ein. Den kanadischen Strang erzählt sie als Robinsonade mit Basiskomfort. Vater und Sohn verstehen sich - und sie verstehen sich als Pioniere. Andreas Landewee, der sein Leben lang Herrschaftsgüter verwaltet hat, belehrt die Einheimischen mit deutscher Gründlichkeit über die im rauhen Norden ungenutzten Möglichkeiten botanischer Artenvielfalt. Unverdrossen plant er Jahrzehnte voraus, er arbeitet lange wie ein Junger und erlebt wirklich noch die Erntezeit seiner unkonventionellen Aufforstung. Bei allem Schönheitssinn ist sein Verhältnis zur Wildnis kein romantisches: "Die Natur ist tief, unerbittlich schön und gefährlich. Sie ist Boden und bodenlos zugleich."
All das ist gediegen erzählt, es gibt einige sehr stimmige Beschreibungen, etwa der gemeinsamen Ritte durch die kanadischen Wälder, des unleugbaren Alterns trotz aller Disziplin oder des Leichenschmauses im Hause Landewee, bei dem sich Andreas' Vater Tafelspitz und Rotkraut schmecken lässt: Mit einer neuen Frau hat er nicht gewartet, bis die seine unter der Erde ist. Trotzdem wird man mit dieser Geschichte nicht ganz glücklich, weil sie hie und da betulich klingt, bald ein wenig überzeichnet, bald allzu putzig, altdeutsch manierlich. Man vermisst Kanten, Schieflagen, Abgründe. Ohne erkennbare erzählerische Strategie plätschert das Leben der beiden Aussteiger im täglichen Gleichmaß dahin. Im Nachwort verrät die Autorin, dass sie mit diesem Buch der Familie ihrer Großmutter nachgespürt habe: Tatsächlich liest es sich, bei allem Erzählgeschick, als wäre es allzu dicht am Leben entlang geschrieben.
Ärgerlich ist, dass der Verlag die durchaus respektable Übersetzung von Judith Dörries nicht sorgfältiger lektoriert hat. Da wird im historischen Kontext "ukrainisch" mit "ruthenisch" verwechselt, und Franz Joseph heißt "Kaiser Franz", da "überschlug sich" der Fuß, Maestro Landewee senior spielt ein "Strauss"-Programm (gewiss ohne Richard), da liest man "Artrose" und "fröhnte".
Die heikelste Zeit wird beim Erinnern nicht ausgespart, aber sie erscheint seltsam undramatisch, beinah wohltemperiert: als die Familie Landewee ihre (alt)österreichische Identität gegen eine reichsdeutsche eintauscht, nolens volens, denn Nazis sind sie nicht, doch beim Einmarsch der Sowjets finden sie sich trotzdem auf der falschen Seite. Andreas, der auf etwas penetrante Weise immer alles richtig macht, muss Hab und Gut aufgeben, genauso wie der Graf, dem er gedient hat, treu und so umfassend, dass er dessen abgelegte Geliebte und Kindsmutter vor den Traualtar führte. Die Flucht findet ein gutes Ende, rasch ist in Westdeutschland eine neue Existenz gegründet. Nur die Ehe mit dem aufgezwungenen Grafenliebchen ist nicht glücklich, aber da trifft der Mann im besten Alter gottlob seine Elisabeth.
Sie hat, wiederum ohne persönliche Beschädigung, im Dritten Reich eine Traumkarriere gemacht. Das "Geschenk aus Berlin", das dem Roman den Titel gibt, ist ein Klavier, und es stammt vom Führer höchstpersönlich. Nicht seinetwegen, versteht sich, hält Andreas es in Ehren: Er lässt es nach Kanada kommen und in seiner Hütte aufstellen, und er spielt darauf Chopin und Beethoven, bis ihm die Finger nicht mehr gehorchen.
DANIELA STRIGL
Lucette ter Borg: "Das Geschenk aus Berlin". Roman. Aus dem Niederländischen übersetzt von Judith Dörries. Wallstein Verlag, Göttingen 2006. 280 S., geb., 19,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Rezensent Michael Rutschky ist zu seinem Bedauern leider unklar geblieben, was dieses Buch eigentlich erzählen will. Gut, die Pointe mit dem Flügel, der vom Führer höchstpersönlich verschenkt worden sei, ist gut gesetzt, der Roman "umsichtig und schön" konstruiert. Allein, wozu weitet die niederländische Autorin ein imaginäres Großdeutschland "in aller Unschuld" von Kiew bis nach Vancouver aus? Der Rezensent hat keine Ahnung. Wenn er die Übersicht über das Personal des Romans verliert, blättert er manchmal zurück. Irgendwie scheint hier jemand von Recherchen über die eigene Familie weit davon getragen worden zu sein, diagnostiziert er mit immer noch wohlwollender Verwirrung angesichts der Verästelungen und Verstrebungen der Handlung. Wenigstens "eine boshafte, finstere Geschichte über 'de Moff'", also die bösen Deutschen sei nicht das Ziel der Autorin gewesen, stellt er am Ende fest. Obwohl die Sache mit dem "Führer-Flügel" eigentlich prädestinierend dafür sei.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH