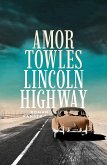Sie führt aus der deutschen Provinz in den Iran und weiter ans Kaspische Meer: die Suche nach Ana Ana, der Tankstellenräuberin, Ana, deren persischer Vater nie so recht hat Fuß fassen können im deutschen Exil. Es ist ein weiter Weg, kreuz und quer durch die Wüste, voller komischer und rätselhafter Prüfungen, die Rupert zu bestehen hat und mit ihm sein schizophrener Freund Robert, der am liebsten Vögel beobachtet, der die Welt nicht versteht und stattdessen das Schachspiel neu erfindet.
So war das zumindest, bis Ana kam. Bis Rupert und Ana abgehauen sind, um das große Leben zu beginnen. Und bevor Ana plötzlich verschwand.
"Das große Leuchten" ist der Roman einer ausgedehnten Reise, abgründig, empfindungsstark und voller abenteuerlicher Echos. Einhörner und Jäger, Derwische und Ex-Generäle, russische Kleinkriminelle, opiumrauchende Kunstfilmerinnen und uralte Orangenfarmer finden darin Platz Figuren, die niemals blinzeln, sondern "brennen, brennen, brennen wie phantastische gelbe Wunderkerzen" (Jack Kerouac).
"Es ist atemraubend, wie präzise, klug und knapp der 1983 in Bonn geborene Autor schreibt, wie lässig, schön und floskellos." WDR
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
So war das zumindest, bis Ana kam. Bis Rupert und Ana abgehauen sind, um das große Leben zu beginnen. Und bevor Ana plötzlich verschwand.
"Das große Leuchten" ist der Roman einer ausgedehnten Reise, abgründig, empfindungsstark und voller abenteuerlicher Echos. Einhörner und Jäger, Derwische und Ex-Generäle, russische Kleinkriminelle, opiumrauchende Kunstfilmerinnen und uralte Orangenfarmer finden darin Platz Figuren, die niemals blinzeln, sondern "brennen, brennen, brennen wie phantastische gelbe Wunderkerzen" (Jack Kerouac).
"Es ist atemraubend, wie präzise, klug und knapp der 1983 in Bonn geborene Autor schreibt, wie lässig, schön und floskellos." WDR
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

In seinem ersten Roman "Das große Leuchten" schickt Andreas Stichmann seine Helden nach Iran und lässt unterwegs auch den mittleren Realismus weit hinter sich
Wann genau es anfängt, ist schwer zu sagen. Da ist dieses Gefühl, dass etwas ins Rutschen gerät, dass eine erzählerische Ordnung schwankt, dass nicht mehr klar ist, wo sich die Geschichte befindet, an welchem Ort, in welchem Aggregatzustand. In Büchern helfen zur Markierung solcher Momente oft Metaphern, die aus dem Kino stammen. Die lautlosen, fast unmerklichen Grenzübertritte von einer Realität in Träume, Halluzinationen oder Phantasmen gleichen Überblendungen. Ein Bild löst sich auf, wie der englische Begriff "Dissolve" es präziser ausdrückt, und zwar in einem anderen Bild.
In der Literatur ist dieser Prozess kein technisch reproduzierbares Verfahren, und der Moment wirkt deshalb vielleicht umso magischer, weil die Materialität der Schrift, der auf Papier gedruckten Buchstaben, sich ja nicht verändert, wenn beim Schreiben und Lesen Welten ineinanderstürzen. Klar, es gibt Signale im Text, wie es im Film Darstellungskonventionen gibt, wenn ein Traum beginnt oder eine Rückblende endet; aber auch diese Signale können trügen wie in den Filmen von David Lynch.
Es gibt nun auch in Andreas Stichmanns Roman "Das große Leuchten" solche kleinen Markierungen, aber sie bleiben entweder schwach oder sehr spielerisch, sie können ihrerseits eher täuschen, als dass sie etwas erklärten; man kann sich nicht sicher sein, wann die Zweifel einsetzen und die Gewissheiten sich nicht wieder einstellen wollen. Und es sind genau diese Übergänge und kleinen Verschiebungen, diese anhaltenden Unschärfen, welche den Roman zu einem kleinen Ereignis machen; es sind - mehr noch als Stoff, Helden, Schauplätze - die verschiedenen Register seiner Prosa, welche eben diese Effekte hervorbringen.
Andreas Stichmann, 1983 geboren, hat am deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert, er reist offenbar gerne, er hat ein paar Monate in Südafrika verbracht und ist durch Iran gefahren, er hat Material daraus gewonnen für seine Bücher, für die Erzählungen in "Jackie in Silber", die 2008 erschienen sind, und eben auch für seinen ersten Roman "Das große Leuchten", der in einer Art literarischer Parallelmontage zwei Geschichten erzählt: von Ruperts und Roberts Reise durch Iran bis ans Kaspische Meer, wo sie Ana suchen; und vom kleinen Wohnwagen- und Aussteigerleben, das Rupert und Ana irgendwo in Deutschland, in einer unbenannten Stadt, geführt haben.
Es ist zum einen die Geschichte von einem Jungen, dessen Mutter eines Tages im rosafarbenen Badewannenwasser liegt. Der 15-jährige Rupert wird von Frances aufgenommen, einer Freundin seiner Mutter mit einem gleichaltrigen, schizophrenen Sohn, Robert. Rupert lernt Ana kennen, Exil-Iranerin, die mit ihrem Vater in einer verschimmelten Wohnung haust. Sie überfallen eine Tankstelle, sie klauen, sie hauen ab und kriechen unter im Wohnwagen einer Frau, die in ihrer "gespielten Jugendlichkeit" wie eine Doppelgängerin von Frances und von Ruperts toter Mutter wirkt. Rupert und Ana schlafen miteinander, in Anas Geruch ist "etwas gleichzeitig Warmes und Unglücklichmachendes", und immer wieder regt sich in Rupert dieses Gefühl, "als wäre mein Ich aufgelöst".
In diese Aussteigergeschichte mischt sich die Sehnsucht nach einem Einstieg, nach Sesshaftigkeit und Familie, der Wunsch, "dass es dort letztlich auch einen Platz für uns geben würde, in der Normalität". In einer ganz starken Szene (die Stichmann auch in Klagenfurt vorgelesen hat) schleicht Rupert spätabends durch die Wohnung einer Kleinfamilie. Aus dem geplanten Einbruch wird der Eintritt in ein anderes Leben. Er beobachtet die banalen Selbstverständlichkeiten des Alltags, geht durch die Wohnung, "und das Ganze ergibt ein Bild aus einem gleichzeitig vergangenen und künftigen Leben". Er wünscht sich, darin aufzugehen, das Kind zu sein, der Vater zu sein, und Ana wäre die Mutter. Dann steht er in der Küche, vor dem verchromten Kühlschrank - "und sah mein Gesicht nicht mehr. Oder vielmehr: Ich sah eins, aber es konnte nicht meins sein, denn so konnte es nicht aussehen, dachte ich, nicht so bleich und nicht so geisterhaft."
Dieses Gefühl, nicht nur nicht zu wissen, wer er ist, sondern zu zweifeln, ob er überhaupt einer ist, zieht sich auch durch die zweite Ebene der Erzählung. Sie wirkt exotischer, welthaltiger, teilweise auch komischer durch die kulturellen Differenzen. Dass es Deutsche gibt, die nicht skypen, verstehen die iranischen Gastgeber nicht, die Rupert und Robert helfen sollen, Ana zu finden, welche die beiden bei ihrer Mutter vermuten. Sie treffen einen Derwisch mit extrem langen Fingernägeln, der Rupert attestiert, nicht vorhanden zu sein: "Er guckt dich an und guckt dich doch nicht an, und du wirst wahnsinnig dadurch, als würde deine körperliche Form verschwimmen, als würdest du dich langsam auflösen."
Die Tonlage ist in diesen Iran-Passagen leicht verändert, der Blick öffnet sich stärker der fremden Welt: "Zwei Hügel schieben sich auseinander, und Teheran schält sich aus dem Nebel. Schleimig gelb und flach und laut. Die Ampeln blinken orange, als wollten sie den Verkehr anfeuern." Sie treffen Frauen, auf deren Köpfen "Frisuren wie brütende Vögel" sitzen, gleiten durch den Morgennebel am Kaspischen Meer, und wo daheim der Raps gelb leuchtet, ist hier der Sonnenaufgang "ein großes, falsches, märchenhaftes Leuchten".
Was sich jetzt, in der gerafften Nacherzählung, so anhört, als sei da letztlich doch ein ganz überschaubarer Plot mit einer Liebes-, Flucht- und Suchgeschichte, die auch jeweils an ihr Ende kommen, ist beim Lesen ungleich schwieriger zu fassen. Es ist eben nicht klar, ob da nun einer gerade einen neuen Raum betritt oder einen Albtraum oder beides zugleich; ob ein Ereignis in der Welt des Romans spielt oder bloß in der Einbildung von einem der Protagonisten; ob der Erzähler verlässliche Fiktion liefert oder die Hirngespinste eines Solipsisten. Man braucht nur mal die Namen der beiden Protagonisten undeutlich vor sich hin zu murmeln, Rupert, Robert, oder das Palindrom in Ana zu sehen, dann verschleifen sich die Unterschiede, dann wird die Schizophrenie des einen womöglich auch eine Sache des anderen. Auch Ana könnte eine Kopfgeburt sein, "ich setzte sie mir einfach ins Bewusstsein"; dann erscheint sie realer, wird wieder zweifelhafter, "aber sie war da gewesen, auf dem Waldboden lag die Birne". Und am Ende hängt eine Postkarte von ihr bei Rupert an der Wand, ein kurzer Gruß aus Holland.
Dieses eigenartige Changieren macht den Reiz des Romans aus. In seinem Erzähllabyrinth entsteht ein ganz eigener Sound, der ab und zu in ein leichtes, durchaus nicht unangenehmes lyrisches Pathos fallen kann, um dann wieder knapper, rauher, umgangssprachlicher, auch lustiger zu werden. Und es ist mindestens so erstaunlich wie erfreulich, dass Stichmann all die Mehrdeutigkeiten nicht doch noch irgendwann einkassiert. Literatur ist halt kein Rubikwürfel, wo die einzelne Teile so lange hin- und hergedreht werden, bis alle Steinchen schön ordentlich zueinanderpassen. Neben all den mal leidlich lustigen, mal tödlich öden Kindheits-, Beziehungs-, Kiez-Nacherzählern, neben all den mittleren Realisten wirkt Andreas Stichmann wie ein Phantast. Wenn er beim Schreiben bleibt, dürfte da noch einiges auf uns warten.
PETER KÖRTE
Andreas Stichmann: "Das große Leuchten". Roman. Rowohlt 2012, 240 Seiten, 19,95 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Rezensent Nico Bleutge wirkt ein bisschen spirituell berührt in seiner Besprechung des ersten Romans von Andreas Stichmann. Oder ist der Roman so? Bleutge versichert zwar das sei alles okay, zwei Freunde, eine Bildungsreise in den Iran (den der Autor gut kennt), der Versuch, Ordnung zu finden in einem chaotischen Leben. Klingt vielleicht ein bisschen altbacken. Laut Bleutge kommt der Autor vom Literaturinstitut Leipzig und kann erzählen, mit kleinen Motiven spielen und auf dem schmalen Grat zwischen Wirklichkeit und Märchen balancieren. Richtig einladend klingt das alles nicht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Es ist atemberaubend, wie präzise, klug und knapp der 1983 in Bonn geborene Autor schreibt, wie lässig, schön und schnörkellos. WDR