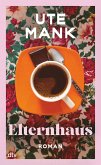Traumatisiert kehrt der Vater aus dem Zweiten Weltkrieg zurück. Und er schweigt. Wenige Jahre vor seinem Tod überreicht ihm Tochter Selma ein Tonbandgerät mit der Bitte, seine Lebensgeschichte festzuhalten: "Für deine Kinder und Enkel, wir wollen wissen, was du im Krieg erlebt hast, um dich besser zu verstehen." Auf der Grundlage dieser Tonband- und weiterer Tagebuchaufzeichnungen ist ein Roman entstanden, der aus verschiedenen Perspektiven die bewegende Geschichte einer Familie im 20. Jahrhundert erzählt. Man begegnet Freuds Psychoanalyse, C.G. Jung, Martin Buber und dem Heiligen Gral, erlebt Krieg, Flucht und Gefangenschaft und die Nachkriegsjahre im zerstörten München anhand eines ehrlich und authentisch geschriebenen Buches.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.