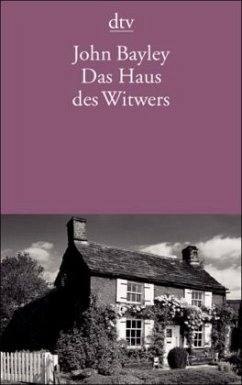Die Fortsetzung von 'Elegie für Iris' - komisch, bewegend und tröstlich
John Bayley, der in 'Elegie für Iris' sein Leben mit Iris Murdoch und die Jahre ihrer Krankheit beschrieben hat, schildert hier seine Erfahrungen als Witwer. Nach dem Tod von Iris überfallen ihn lähmende Verlustgefühle. In dieser Situation tauchen Margot und Mella, eine Freundin von Iris und ihre Tochter, auf - zunächst ohne voneinander zu wissen -, um ihn mit gutem Essen, ordentlichem Hausputz, weiblichen Reizen und Sex aufzuheitern.
Sie erreichen jedoch das Gegenteil; Bayley ergreift die Flucht und beginnt zu reisen. Während eines Aufenthaltes bei einer langjährigen Freundin auf Lanzarote findet er einen Weg, mit seinen Erinnerungen, seiner Trauer und dem Witwerdasein umzugehen und kann schließlich seinen Blick hoffnungsvoll nach vorn richten. »Vielleicht war es ja nur der spanische Rotwein, aber es hatte wirklich den Anschein, als hätten sich alle Ängste und Verluste auf wunderbare Weise in Luft aufgelöst.«
John Bayley, der in 'Elegie für Iris' sein Leben mit Iris Murdoch und die Jahre ihrer Krankheit beschrieben hat, schildert hier seine Erfahrungen als Witwer. Nach dem Tod von Iris überfallen ihn lähmende Verlustgefühle. In dieser Situation tauchen Margot und Mella, eine Freundin von Iris und ihre Tochter, auf - zunächst ohne voneinander zu wissen -, um ihn mit gutem Essen, ordentlichem Hausputz, weiblichen Reizen und Sex aufzuheitern.
Sie erreichen jedoch das Gegenteil; Bayley ergreift die Flucht und beginnt zu reisen. Während eines Aufenthaltes bei einer langjährigen Freundin auf Lanzarote findet er einen Weg, mit seinen Erinnerungen, seiner Trauer und dem Witwerdasein umzugehen und kann schließlich seinen Blick hoffnungsvoll nach vorn richten. »Vielleicht war es ja nur der spanische Rotwein, aber es hatte wirklich den Anschein, als hätten sich alle Ängste und Verluste auf wunderbare Weise in Luft aufgelöst.«

„Das Haus des Witwers”: John
Bayley erinnert sich kaum an Iris
Wenn Prominente das Zeitliche segnen, ist, wie man weiß, beileibe nicht alles vorbei. Vielmehr geht es nun in gewissem Sinne überhaupt erst richtig los. Die Umgebung der Prominenten überfällt jäh der Drang, sich dem Rest der Menschheit mitzuteilen. Was der Verblichene ihnen bedeutet hat, mehr noch, was sie dem Verblichenen bedeutet haben: das will ausführlich zu Papier gebracht sein. Im Fall der 1999 verstorbenen angloirischen Schriftstellerin Iris Murdoch hat der Wunsch, sich einmal in diesem Sinne zu äußern, mit besonderer Vehemenz ihren Ehemann, den Literaturwissenschaftler John Bayley, gepackt. Nicht weniger als drei Erinnerungsbücher hat er schon auf den Markt geworfen: auf „Iris – A Memoir of Iris Murdoch” folgte erst „Iris and the Friends”, dann „Widower’s House”, nun von C.H. Beck auf deutsch vorgelegt – in einer flüssigen Übersetzung von Barbara Rojahn-Deyk.
Das Geschäft mit der Erinnerung begann noch zu Lebzeiten der Erinnerten: das erstgenannte Buch erschien bereits 1998. Dank Morbus Alzheimer war Dame Iris schon zu weggetreten, um Einspruch dagegen erheben zu können, dass es Bayley mit dem Nachruf auf sie so arg pressierte. Folgerichtig nun, dass im neuesten Buch die Hauptperson nicht mehr Iris Murdoch, sondern John Bayley heißt. Dass man, sich an Berühmte erinnernd, selber berühmt werden kann, hat inzwischen der hübsch gemachte Film von Richard Eyre ratifiziert.
Sturz in die Witwerschaft
Was nun passiert Bayley Mitteilenswertes? Zunächst einmal sitzt er dem schwer begreiflichen Glauben auf – der aber immerhin seiner Erfahrung entsprechen mag –, Liebe sei eine Art Kuschelecke, gemütlich und geschützt: „Da war die Welt sinnvoll. Da hatte ich Vertrauen zu ihr. Iris war Glaube und Vertrauen. Und auch Sicherheit”. Nachdem dergestalt alles Prekäre, Abgründige und Zweideutige der Liebe an John Bayley anscheinend ziemlich unbemerkt vorbeigegangen ist, nimmt es nicht weiter wunder, dass sich ihm die Witwerschaft vor der Hand als Sturz in die harte, böse Welt darstellt. Und ihn darum anfällig macht für noch mehr Kuschelei. So macht er sich selbst zum Opfer der Anteilnahme und Zuwendung des weiblichen Geschlechts. Zwei Vertreterinnen desselben, eine jüngere sowie eine reiferen Jahrgangs, kochen ihm Schmorfleisch, bringen ihm leckere Pasteten, putzen sein Haus, kriechen in sein Bett; die jüngere lässt sich gar von dem Endsiebziger beschlafen.
Bayley reagiert auf das Angebot solcher Fürsorge opportunistisch: er will ihm entnehmen, was ihm passt. Aber die Rechnung geht nicht auf: zumindest die jüngere der beiden Damen ist nur ganz oder gar nicht zu haben. Als sie sich entschlossen in sein Oxforder Haus einquartiert, bleibt ihm nurmehr die Flucht nach Lanzarote.
Bayleys Buch ist flach, redselig und gleichwohl auf eine bestimmte Art kurzweilig. Man legt es aus der Hand in dem Gefühl, einem Sonntagnachmittagsgeplauder beigewohnt zu haben. Unterhaltsam wird das Buch stets, wenn die beiden Damen die Initiative haben und Bayleys Haus belagern. Ermüdend sind hingegen die Reflexionen, die Bayley insbesondere in der Mitte des Buches in endloser Suada ausbreitet. Ganz ungenießbar wird die Sache, wenn er auf Dichtung zu sprechen kommt; ,mit dem Dichter auf Du und Du‘ ist der biedere, nein anbiedernde Refrain dieses Literaturprofessors im Ruhestand: „Und doch hätte ihm” – Coleridge – „unser Abendessen bestimmt sehr gut gefallen”.
Ist damit ein Tiefpunkt des Niveaus bezeichnet, so darf auch das Beste nicht verschwiegen werden: Leander Eisenmann hat für das Buch einen vollendet ingeniösen Umschlag gestaltet, zwei Schatten auf einer altmodisch ornamentierten Tapete. So subtil ist dieser Einband, dass ich ihn mir an die Wand gehängt habe und alle paar Stunden mit Vergnügen beschaue.
ANDREAS
DORSCHEL
JOHN BAYLEY: Das Haus des Witwers. Aus dem Englischen von Barbara Rojahn- Deyk. Verlag C.H. Beck, München 2002. 271 Seiten, 18,50 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de
"Tausende von Lesern waren dankbar für "Elegie für Iris", nicht nur, weil es ein so bewegender Bericht der Hingabe in Krankheit und Gesundheit war, sondern das Portrait der brillanten, exzentrischen Iris Murdoch." (New York Times)