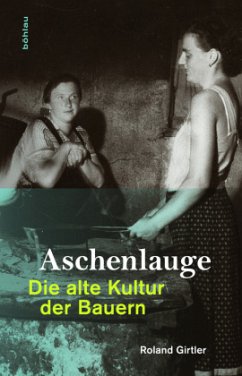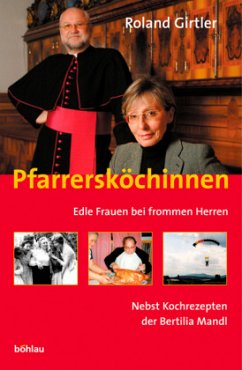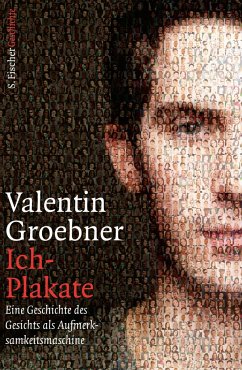Nicht lieferbar
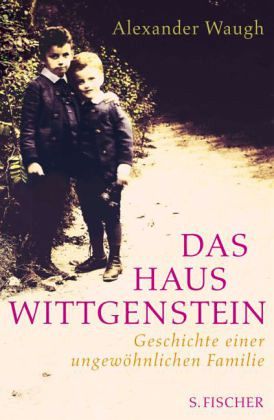
Das Haus Wittgenstein
Geschichte einer ungewöhnlichen Familie
Übersetzung: Röckel, Susanne
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Die Wittgensteins gehören zu den schillerndsten Familien des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts. Vater Karl hatte es als Stahlmagnat zu großem Vermögen gebracht und führte ein offenes Haus, in dem Musiker wie Brahms, Mahler oder Richard Strauss und die Wiener Avantgarde verkehrten. Seine Kinder jedoch litten unter dem strengen Vater: Drei der fünf Söhne brachten sich um, einer verschenkte sein Erbe und wurde ein weltbekannter Philosoph, einer blieb Pianist, der trotz fehlender rechter Hand konzertierte und sich von Ravel, Hindemith, Prokofjew oder Britten Stücke komponieren ließ....
Die Wittgensteins gehören zu den schillerndsten Familien des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts. Vater Karl hatte es als Stahlmagnat zu großem Vermögen gebracht und führte ein offenes Haus, in dem Musiker wie Brahms, Mahler oder Richard Strauss und die Wiener Avantgarde verkehrten. Seine Kinder jedoch litten unter dem strengen Vater: Drei der fünf Söhne brachten sich um, einer verschenkte sein Erbe und wurde ein weltbekannter Philosoph, einer blieb Pianist, der trotz fehlender rechter Hand konzertierte und sich von Ravel, Hindemith, Prokofjew oder Britten Stücke komponieren ließ.
In seiner faszinierenden Biographie schildert Alexander Waugh die gesamte Tragik und Größe einer Familie vor dem Hintergrund zweier Weltkriege und dem Nationalsozialismus. Entstanden ist das erschütternde Portrait einer Familie so hochbegabter wie schwieriger Menschen.
In seiner faszinierenden Biographie schildert Alexander Waugh die gesamte Tragik und Größe einer Familie vor dem Hintergrund zweier Weltkriege und dem Nationalsozialismus. Entstanden ist das erschütternde Portrait einer Familie so hochbegabter wie schwieriger Menschen.