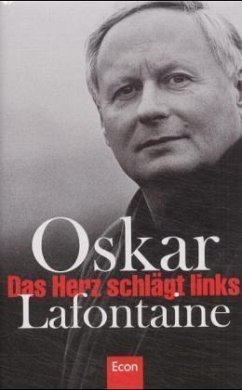Vom Mannheimer Parteitag 1995, als er handstreichartig den glücklosen Rudolf Scharping im SPD-Vorsitz ablöste, bis zum unheimlichen Abgang nach 136 Tagen aus der Regierung Schröder - Oskar Lafontaine berichtet erstmals offen über die inhaltlichen und persönlichen Kämpfe in Partei und Regierung und schildert die Gründe, die im März 1999 zu seinem Rücktritt als Parteivorsitzender und Finanzminister führten.

Die Finanzkrise klingt wie ein Echo seiner Warnungen von 1999. Eine Revision von "Das Herz schlägt links"
Hat die doppelte Krise und Beinahe-Kernschmelze, die uns in diesen Wochen beschäftigte, also die der internationalen Finanzmärkte und der deutschen Sozialdemokratie, eine gemeinsame Ursache? Wurde im Jahre 1999 eine rote Ampel überfahren, und folgen wir seitdem dämlich dämmernd einem Irrweg bis zum unausweichlichen Frontalzusammenstoß? Hätten wir es statt mit Gerhard Schröder lieber mit Oskar Lafontaine halten sollen, dessen Herz links schlägt, während bei Schröder - frei nach einem alten Bonmot von Kissinger vor der eigenen Herzoperation - die Nachricht schon wäre, dass er überhaupt ein Herz hat?
Es ist eine Frage, die viele beschäftigt. Oskar ist es schließlich zuzutrauen, den einst unter Rot-Grün entfesselten, nun mit klammen Fingern am Abgrund hängenden Finanzhelden in einem XXL-T-Shirt mit der Aufschrift "Ätsch!" zu begegnen.
In der ARD-Sendung "Maischberger" vom vergangenen Montag warf Hans-Jochen Vogel spontan die Frage auf, ob es nicht zwei Oskars gebe: den erfolgreichen Ministerpräsidenten und SPD-Vorsitzenden und dann den, der in der "Bild" gegen die von seinen Genossen geführte Bundesregierung schreibt. Und Hans-Olaf Henkel, der sich gegenwärtig lieber mit Geschichten aus der Vergangenheit hervortut - könnte ja sonst mal jemand fragen, wer denn nun mehr Geld vernichtet hat, die Sozialtransferbezieher, die er jahrelang als Hängemattenbewohner verhöhnt hat, oder seine Helden von den Finanzmärkten -, Henkel jedenfalls hatte eine Ferndiagnose parat: Das Kölner Attentat 1990 sei es gewesen, das den einstigen "Modernisierer" - Oskar warb in den achtziger Jahren tatsächlich für längere Maschinenlaufzeiten und Arbeitszeit ohne vollen Lohnausgleich - in einen gefährlichen Sozialisten verwandelt habe. Offenbar schien ihm das Messer einer Wahnsinnigen weniger unheimlich als die Frage, ob nicht Sozialismus heute modern sei.
Messerstich oder Verdopplung: Warum hat Oskar uns verlassen, oder wir ihn? Und wäre mit ihm alles besser? Die Lage links von der Union ist heikel: Oskar Lafontaine, das erstaunlichste Comeback-Kid, das die deutsche Politik je gesehen hat, verhindert eine rot-rote Koalition, weil viele Sozialdemokraten von ihm angewidert sind, und er ermöglicht sie zugleich: Niemand widerlegt das Zerrbild der Linken als Verein der Verfassungsfeinde besser als einer, den die SPD zum Bundeskanzler machen wollte und der an der Saar im dunkelblauen Zweireiher Orden verteilt, Grundsteine gelegt und rote Bänder durchgeschnitten hat, Monsieur Staat persönlich.
Behält er angesichts des Kollaps der Märkte gerade recht? Lesen wir dazu noch mal das 1999 erschienene lange Buch zum schnellen Rücktritt "Das Herz schlägt links".
Interessanterweise wendet Oskar darin - das Buch wurde vor seinem Wechsel zur Linken und vor der Agenda geschrieben - große Mühe darauf darzulegen, dass sein Herz gar nicht so weit links schlägt. Seitenweise legt er dar, dass seine wirtschaftspolitischen Vorstellungen mit denen des Harvard-Ökonomen Paul Krugman und des großen britischen Soziologen und Tony-Blair-Gurus Anthony Giddens übereinstimmten. Die Botschaft des Buches lautet: Nicht ich bin ausgeflippt und nach links gerückt, Schröder ist an allem schuld. Der von Lafontaine am häufigsten zitierte Theoretiker ist nicht Karl Marx, sondern Helmut Schmidt.
Einen weit größeren Raum als alle inhaltlichen Divergenzen nehmen persönliche Kränkungen ein. Die Finanzmärkte tauchen da an einer typischen Stelle auf: Im Buch wird ein handfester Streit zwischen Schröder und Lafontaine geschildert, der schon früher beinahe zum Rücktritt des Finanzministers geführt hätte.
Es ging um eine Personalsache, nein, nicht mal darum, bloß um eine "Der sagt, dass du sagst"-Geschichte wie auf dem Schulhof und letztlich darum, wer der Chef ist. Jedenfalls redet Schröder an jenem Tag grad nicht mehr mit Oskar. Am Abend ruft Schröders Ehefrau in Saarbrücken an und fragt, was los sei, Gerd sei schmollend zu Bett gegangen. Die Frauen reden miteinander, Schröder wird aus dem Bett geholt, murmelt eine Entschuldigung, und Oskar fällt ein, dass er ja noch was vorhat, Montag im Büro: "Ich wollte als Finanzminister auf eine Neuordnung der Weltfinanzmärkte hinwirken, um die Währungsspekulation zu bekämpfen." Also bleibt er, erst mal.
Wer das nicht einmal zehn Jahre alte Buch liest, kann nur staunen, wie dicht und ereignisreich die Zeit seitdem verlaufen ist. Im Buch ist Bonn der Sitz der Regierung, alles wird in Deutscher Mark berechnet, und das Festnetztelefon ist das modernste Kommunikationsmittel. Frank-Walter Steinmeier wird von Oskar aus höchster Höhe als exzellenter Administrator gelobt - nicht so ein Luftikus wie sein Vorgänger Bodo Hombach oder sein Chef Schröder - und Franz Müntefering ist ein fleißiges Männlein aus der zweiten Reihe. Jedes Absinken der SPD unter vierzig Prozent ist eine Katastrophe. Darum ist das Urteil nach neuerlicher Lektüre für den Autor ungünstig: Seine Empfindlichkeiten haben ihm den Sinn dafür genommen, dass das ja die guten Zeiten waren, vor Bush und dem 11. September. Man hätte als Staatsmann vorhersehen müssen, dass die Gestaltungsspielräume auch mal enger werden als beim Beharken mit der Union über das Schlechtwettergeld für Bauarbeiter. Man hätte diesen historischen Moment nutzen müssen. Offenbar bestand, so Lafontaines Darstellung, damals ein gewisses gutes Einvernehmen zwischen Lafontaine, dem französischen Finanzminister Dominique Strauss-Kahn, dem damaligen Schatzkanzler Gordon Brown und Clintons Finanzminister Robert Rubin. Alle waren sich einig, dass die Finanzmärkte eine vernünftige Aufsicht brauchen - sicher in graduellen Unterschieden, aber das Prinzip war allen klar. Und auch Schröder hatte nichts dagegen. Welche historische Gelegenheit wurde da vertan! Es wäre ein internationales Bündnis der Vorsicht auf Dauer geworden: Heute ist Strauss-Kahn Chef des Internationalen Währungsfonds, Gordon Brown britischer Premier und Rubin ein emsiger Berater von Barack Obama.
Die theoretische Seite des Buchs, also das Plädoyer für eine selbstbewusste Kontrolle der Finanzspekulationen durch die Regierung, bleibt aktuell, auch wenn sich in der dauernden Wiederholung dieser Forderung eher die Abneigung Lafontaines gegen die Entstehung eines Machtzentrums neben seiner eigenen politischen Macht ausdrücken könnte als ein tiefes Verständnis der wirtschaftlichen Risiken von Derivatgeschäften. Als zentraler Vorwurf Lafontaines an Schröder bleibt, der sei nicht zum Mannschaftsspiel fähig gewesen. Wobei er fairerweise betont, Schröder habe ihn nie aus Politik und Partei herausdrängen wollen, den Fraktionsvorsitz hatte er für ihn vorgesehen. Auch hier war die Geschichte dem Autor eher ungnädig: Man mag Schröder einiges vorwerfen, aber dass er grundsätzlich nicht mit anderen zusammenarbeiten könne, stimmt nicht: Mit Fischer, Müntefering, Clement und Schily, kein Club der verhuschten Egos, hat er es lange ausgehalten. Heute arbeitet er eher zu gut mit den falschen Leuten zusammen. Es ging damals lediglich um die Frage, wer bestimmt. Viel Phantasie war da nicht im Spiel.
Gerade als Sozialdemokrat hätte sich bei Lafontaine aber die Einsicht durchsetzen müssen, dass der Kompromiss, also das zähe Feilschen an den Details, später etwa der Agenda, wichtiger gewesen wäre als so ein blödes Drama. Es ist unangenehm, von Schröder schlecht behandelt zu werden, aber es gibt Schlimmeres - na, und das ist dann auch eingetreten.
Lafontaine hat das Problem der deregulierten Finanzmärkte in ruhigen Zeiten verstanden, aber nicht tapfer und dauerhaft zu lösen versucht, obwohl er es vielleicht gekonnt hätte. Warum also sollte man es in unruhigen Zeiten an ungünstigerer Stelle wieder mit ihm versuchen?
NILS MINKMAR
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Laut Herbert Riehl-Heyse hat sich Oskar Lafontaine mit diesem Buch keinen Gefallen getan. Zu sehr steht für ihn der Abrechnungscharakter und die persönliche Gekränktheit des Autors im Vordergrund, und er ist überrascht, wie weit Lafontaines Empfindlichkeiten gehen: Da reiche es bisweilen schon, dass eine Begrüssung nicht freundlich genug ausgefallen ist oder ein Kollege in der Presse besser abschneiden konnte. Den Rezensenten erinnert das an "nervöse Operndiven" und er wundert sich, wieviel Energie durch diese Verletzlichkeiten in der Politik vergeudet wird. Riehl-Heyse kritisiert ausserdem, dass Lafontaine auch an der Presse kein gutes Haar lässt - es sei denn natürlich, sie berichtet positiv über ihn. Was den theoretischen Teil betrifft, entdeckt Riehl-Heyse zwar einige diskussionswürdige Aspekte, allerdings merkt er an, dass Lafontaine diese Fragen sehr viel effektiver zur Debatte hätte stellen können, wenn er im Amt geblieben wäre.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH