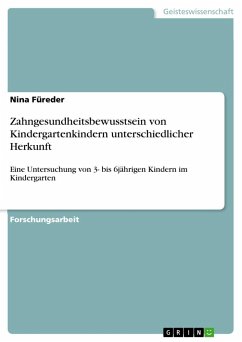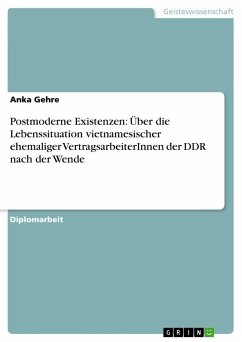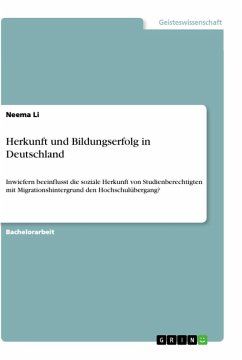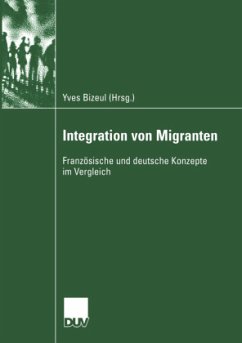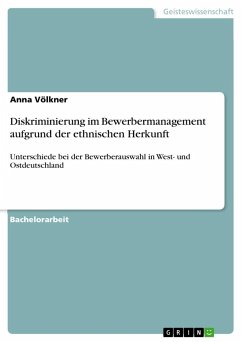Nicht lieferbar
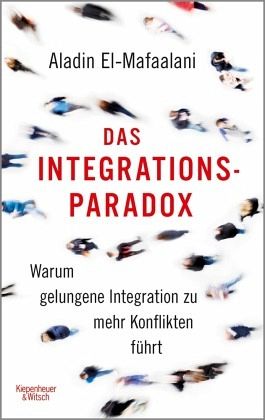
Das Integrationsparadox
Warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Zusammenwachsen tut wehWer davon ausgeht, dass Konfliktfreiheit ein Gradmesser für gelungene Integration und eine offene Gesellschaft ist, der irrt. Konflikte entstehen nicht, weil die Integration von Migranten und Minderheiten fehlschlägt, sondern weil sie zunehmend gelingt. Gesellschaftliches Zusammenwachsen erzeugt Kontroversen und populistische Abwehrreaktionen - in Deutschland und weltweit. Aladin El-Mafaalani nimmt in seiner Gegenwartsdiagnose eine völlige Neubewertung der heutigen Situation vor. Wer dieses Buch gelesen hat, wird- verstehen, warum Migration dauerhaft ein Thema bleiben...
Zusammenwachsen tut wehWer davon ausgeht, dass Konfliktfreiheit ein Gradmesser für gelungene Integration und eine offene Gesellschaft ist, der irrt. Konflikte entstehen nicht, weil die Integration von Migranten und Minderheiten fehlschlägt, sondern weil sie zunehmend gelingt. Gesellschaftliches Zusammenwachsen erzeugt Kontroversen und populistische Abwehrreaktionen - in Deutschland und weltweit. Aladin El-Mafaalani nimmt in seiner Gegenwartsdiagnose eine völlige Neubewertung der heutigen Situation vor. Wer dieses Buch gelesen hat, wird- verstehen, warum Migration dauerhaft ein Thema bleiben wird und welche paradoxen Effekte Integration hat- erfahren, woher die extremen Gegenreaktionen kommen- in Diskussionen besser gegen Multikulti-Romantiker auf der einen und Abschottungsbefürworter auf der anderen Seite gewappnet sein- erkennen, dass es in Deutschland nie eine bessere Zeit gab als heute und dass wir vor ganz anderen Herausforderungen stehen, als gedacht