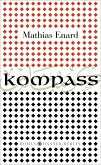UNVERHOFFTE ERBSCHAFT IN MÜNCHNER PROMIVIERTELDieser Mann ist ein Glückspilz: Von der Tante einer Tante erbt er in bester Lage Münchens ein großes Mietshaus. Also hängt er seinen Job als Archivar an den Nagel, bricht alle Zelte ab und zieht in eine freie Wohnung seines neuen Hauses ein. Unter falschem Namen, versteht sich, immerhin will er dem Müßiggang frönen und sich nicht unnötig mit seinen Mietern herumschlagen. Da hat er die Rechnung ohne die illustre Nachbarschaft gemacht: vom unbeugsamen Derivatehändler und der notorisch einsamen Studienrätin bis zum Vorgänger in seiner Wohnung, ein Schriftsteller, der überall Spuren hinterlassen hat und immer noch sonderbare Post erhält. DER SCHRIFTSTELLER UND DIE STALKERINKurzerhand beschließt der Mann, in die Haut des ominösen Autors zu schlüpfen. Er kopiert dessen Schrift, trägt dessen Gedichte vor, eignet sich das Verhalten eines echten Schriftstellers an und erkundet, wie sich dieses neue Leben anfühlt. Bis eines Tages eine Nichte desselben vor der Tür steht, und kurz darauf eine Frau, die behauptet, er habe ihre Werke plagiiert und gestohlen. Was tun? Aus dem Einsamen wird ein Verfolgter. Als die Schlinge sich immer stärker zuzieht, plant er seine Flucht.WUNDERBAR HINTERSINNIGER UND HINREISSEND KOMISCHER ROMAN VON VERLEGERLEGENDE MICHAEL KRÜGERNach der "Turiner Komödie" und dem Erzählband "Der Gott hinter dem Fenster" legt Autor und Verlegerlegende Michael Krüger sein neues Prosawerk vor: ein vergnüglicher Roman, in dem er wunderbar hintersinnig und hinreißend komisch einen Käfig voller Narren mitten in München porträtiert. Zugleich erzählt er die Geschichte eines Mannes, der mit dem Glück, das ihm in den Schoß fällt, partout nichts anfangen kann ...
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Michael Krügers Roman "Das Irrenhaus"
Das Leben sei ihm zu nahe gekommen, teilt der Ich-Erzähler gleich auf der ersten Seite mit. Dabei ging er bisher einem Beruf nach, der nicht im Ruf steht, von bedrängender Lebensfülle zu sein: Archivar bei einer Zeitung. Nun braucht die Zeitung dank Digitalisierung keinen Archivar mehr, und der kann sein Hobby zur Hauptsache machen. Seit vielen Jahren erforscht er die Langeweile; jetzt kann er sie endlich auch "mit Hingabe" praktizieren: "Ein Leergelassensein von der Welt wollte ich erreichen."
Aber was wird aus der schönsten heideggerisierenden Weltentleerung, wenn bald auch das Konto leer ist? Da trifft es sich wunderbar, dass der Erzähler gerade eine erhebliche Erbschaft antreten durfte: Die ihm persönlich kaum bekannte "Tante einer Tante" hat ihm ein größeres Mietshaus in bester Münchner Lage vermacht; die Mieteinnahmen ermöglichen ihm nun den Luxus des Nichtstuns, gewürzt mit schöner Lektüre und Musik, bevorzugt Sibelius, "Aus banger Brust", Opus 50. Allerdings begeht er einen schweren Fehler, der den Roman erst in Gang bringt: Er zieht selbst in eine leere Wohnung seines Hauses ein, inkognito, niemand soll hinter dem "freien Philosophen" den Hausbesitzer erkennen. Aber auch so ist es mit der kontemplativen Ruhe bald vorbei; die zudringlichen Hausbewohner sorgen dafür.
Da ist zum Beispiel Herr Schwan, ein "moderner Wicht" in "lächerlichem Aufzug", der im Gespräch "wie ein Tier" an seinen Nagelbetten herumreißt, bis es blutet. Die zerkauten Hautfetzen spuckt der abstoßende Nager auf den Fußboden. "Er frisst sich selber auf, dachte ich, und zwar nicht aus Hunger, wie in der Sage, sondern aus Gier." Das passt zu seiner Profession, denn Herr Schwan handelt mit Derivaten und "Bonuspapieren" und will sie auch dem neuen Mitbewohner aufschwatzen. Als wäre dem Leser die Sympathie- oder vielmehr Antipathielenkung nicht längst klar, heißt es nach Schwans Auftritt: "Er kam mir vulgär vor und abgeschmackt." Das gilt nicht weniger für einen weiteren Hausbewohner, Herrn Netzeband, einen knopfäugigen Mann, der jeden Zuhörer für die lukrative Revolutionierung des Bestattungswesens gewinnen möchte: Friedhöfe zu Wohngebieten, Verkehrsinseln zu Urnengräbern. Kurz: "ein widerlicher Glatzkopf, der die Totenruhe stören wollte". Natürlich gehört auch ein freischaffender Psychoanalytiker zu den Mietern.
Ist es verdrossener Humor oder humoristischer Verdruss? Jedenfalls liefert Michael Krüger mit seinem neuen Roman ein misanthropisches Pandämonium der Gemeinheit. Widerliche Männer, abstoßende Frauen, wohin das Auge blickt, selbst das bloße Schauen aus dem Fenster trägt dem Erzähler ein weiteres Exemplar für seine Galerie der Unmenschen ein: Da steht vor dem Supermarkt ein alter Mann, scheint nur ein harmloser vor sich hinmurmelnder Bettler zu sein, ist in Wahrheit aber ein hinterhältiger Hundequäler, der die dort angeleinten Wir-müssen-leider-draußen-bleiben-Kreaturen so fest wie möglich tritt, wenn er sich unbeobachtet glaubt - ein Repräsentant des sadistischen Universums.
Nur ein Mensch wird dem Hauseigentümer immer sympathischer und faszinierender: der Naturlyriker Georg Faust, der zuvor in seiner Wohnung lebte und eines Tages einfach verschwunden ist. Noch immer trifft Post für den verschollenen Schriftsteller ein; und allein aus den mit Bedauern von den Verlagen zurückgesandten Manuskripten ergeben sich für den Ich-Erzähler die Konturen eines faszinierenden melancholiegetränkten Werkes. Immer mehr fühlt sich der Ich-Erzähler ein in die faustische Dichter-Existenz; umgekehrt bemächtigt sich der ominöse Georg Faust seines Lebens. Im Zuge seiner Verwandlung wird er nun öfter mit dem Dichter verwechselt und schließlich sogar zu einem Schriftstellerkongress eingeladen, was dem Roman weitere skurrile Gestalten einträgt. Und natürlich hört man genau hin, wenn ein Ex-Verleger wie Michael Krüger seine Figuren über das literarische Leben klagen lässt. Gerade deshalb enttäuscht es ein wenig, dass die Pointen - etwa über Buchhandelslesungen, Autorenneid oder Mutterbeschimpfungsprosa - zwar treffen, aber nicht ganz frisch wirken.
"Das Irrenhaus" ist ein Verdrussroman von bissiger Heiterkeit - die Lage des Ich-Erzählers wird immer verworrener, bis er im verknäulten Labyrinth der Spaghetti auf dem Teller ein treffendes Abbild seines Zustands sieht. Es ist keine realistische Sozialstudie, wie man es von einem Miethausroman erwarten könnte, sondern die ins Kafkaeske tendierende Beichte eines Mannes, der sich im Leben immer fremder fühlt: "Ich sitze in meinem eigenen Haus, bin aber nicht nach Hause gekommen." Solche schönen Sätze entschädigen für die konstruiert und bemüht wirkende Handlung des Romans. Er lebt von Details, von scharfen, bisweilen überscharfen Beobachtungen, gewitzten Reflexionen und überraschenden lyrischen Momenten.
WOLFGANG SCHNEIDER.
Michael Krüger: "Das Irrenhaus". Roman.
Haymon Verlag, Innsbruck und Wien 2016. 190 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Das ist ein großartiger, melancholischer, kluger Roman über die Welt, in der wir leben, und die Absurditäten, die uns darin begegnen, die uns aber allzu oft viel zu normal erscheinen, um sie noch zu bemerken. Michael Krüger sieht sie und beschreibt sie ganz wunderbar." SWR-Lesenswert, Felicitas von Lovenberg "von scharfen, bisweilen überscharfen Beobachtungen, gewitzten Reflexionen und überraschend lyrischen Momenten" FAZ, Wolfgang Schneider "Michael Krüger schreibt mit Witz, Verve und leichter Hand." NZZ am Sonntag, Manfred Papst "Michael Krügers 'Irrenhaus' ist gesättigt mit Ironie und parodistischen Anspielungen und damit auch höchst amüsant. Denn natürlich weiss der Autor als langjähriger Verleger eine Menge zu erzählen über die Abgründe der schreibenden Zunft. Und Krüger, das zeigt sich auf jeder Seite, ist ein leichtfüssiger Erzähler, elegant und gescheit. Sein heiterer Skeptizismus ist eine grosse Wohltat und der schönste Ausweg aus dem 'Irrenhaus'." NZZ, Martin Zingg"Michael Krüger erzählt vom Scheitern, von Gescheiterten und der Fragilität des Seins. Sein 'Irrenhaus' ist ein Kuriositätenkabinett, das er mit kluger, wohltemperierter Stimme beschreibt." SZ-Magazin "Ein besonders feiner, ironischer, sowie melancholischer Betrachter menschlichen Treibens." Bayrischer Rundfunk, Bernhard Setzwein "Ein ironisches Spiel mit Lebensentwürfen" Hessischer Rundfunk, Sylvia Schwab "Eine schöne kleine Satire, eine launige Schnurre, die mit vielen literarischen Motiven spielt." Nürnberger Nachrichten, Wolf Ebersberger "brillanter, sprachmächtiger Fabulierer" NEWS, Heinz Sichrovsky "ein literarisches Kleinod" Wienerzeitung, Mathias Ziegler "... ein mit allen erzählerischen Wassern gewaschenes Vexierspiel, gespickt mit ironischen Späßen und bitterbösen Betrachtungen zur Zeit." Tiroler Tageszeitung, Joachim Leitner