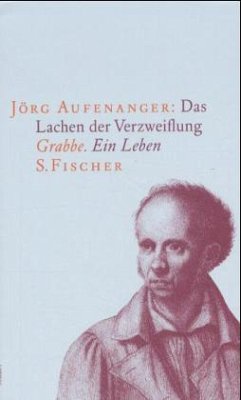Christian Dietrich Grabbe (1801-1836) ist die wohl tragischste Figur der deutschen Literatur und des deutschen Theaters. Von früher Kindheit an faszinierte Grabbe die Bühne, doch seine Liebe zum Theater blieb unerwidert. Weder als Schauspieler noch als Dichter fand er zu Lebzeiten die ersehnte Anerkennung. So tragisch Grabbes Leben gewesen ist, er hat der Literatur viel gegeben: Dieser Dichter wollte das Theater revolutionieren, doch erst nach seinem Tod wurde er als Vorläufer des modernen Theaters entdeckt. Jörg Aufenanger erzählt das Leben, Schreiben und Scheitern Grabbes in einer behutsamen Annäherung an den Menschen und sein Werk.

Jörg Aufenangers Grabbe-Biographie schürft an der Oberfläche
"Es gibt unausweichliche Verhängnisse; es gibt in der Literatur jedes Landes Menschen, die das Wort ,guignon' - ,Pech' - in geheimnisvollen Zeichen in die gewundenen Falten ihrer Stirn geschrieben tragen." Mit diesen Worten beginnt Charles Baudelaires großer Essay über Edgar Allan Poe; unter der gleichen Formel ist aber seit jeher auch das Leben Christian Dietrich Grabbes gesehen worden, von den Zeitgenossen genauso wie von allen Späteren. Als Grabbe 1836 im Alter von fünfunddreißig Jahren elend zugrunde gegangen war, hatte er eine Handvoll Dramen und ein paar Aufsätze und Theaterkritiken veröffentlicht. Nur ein einziges Stück war jemals aufgeführt worden, und das auch nur ein einziges Mal, mehr als Zeichen des guten Willens des Detmolder Theaters, dessen Schauspieler von Grabbe rüde attackiert worden waren und die sich dann bitter gerächt hatten. Als Bühnenautor, im bürgerlichen Leben, in der Ehe gescheitert, bettelarm, gesundheitlich zerrüttet, dem Alkohol verfallen, kehrte er zuletzt in seine Heimatstadt Detmold zurück und starb.
Heute ist seine literaturgeschichtliche Leistung als Wegbereiter der Moderne unumstritten, auch wenn seine dramaturgisch schwer zu meisternden Stücke seltene Gäste auf dem Spielplan geblieben sind. Sosehr Grabbe mit fasziniertem Staunen, Abscheu oder Mitleid als gescheitertes oder, weniger freundlich, als verkommenes Genie gesehen wurde - ein verkanntes war er nicht. Tieck, Heine, Immermann haben ihm zu Lebzeiten Respekt gezollt und nach ihnen Wedekind, Alfred Jarry, Brecht und zuletzt Heiner Müller.
Bereits den Zeitgenossen und seinen ersten Biographen war klar - und daran hat sich bis heute nichts geändert -, daß der katastrophale Gang von Grabbes Leben in einem irreparablen Mißverhältnis von angeborener Individualität, hochfahrenden Lebensplänen, drückender Umgebung und widerstreitendem Zeitalter wurzelte - was in dieser Allgemeinheit natürlich eine ziemlich banale Einsicht ist. Sie zu präzisieren und an einem exemplarischen Fall das Leben eines ungemein talentierten, aber gefährdeten Menschen unter den krisenhaften Bedingungen des gesellschaftlichen Übergangs zur Moderne darzustellen: Das ist die anspruchsvolle Aufgabe einer kritischen Grabbe-Biographie, die es bislang noch nicht gibt.
Dabei ist die Materiallage günstig: Alfred Bergmann hat in lebenslanger Arbeit alle irgend erreichbaren Dokumente zusammengetragen, sie akribisch auf ihren Tatsachengehalt geprüft und in zahllosen Veröffentlichungen zugänglich gemacht; nur die umfassende kritische Biographie hat Bergmann nicht geschrieben. Jörg Aufenanger auch nicht. Er hat mit Geschick für ein allgemeines Publikum aufgearbeitet, was Bergmann zusammengetragen hat. Eigene Forschungen hat er nicht angestellt. Sein Grabbe-Buch ist eine flüssig lesbare Kompilation, bereichert um einen Überblick über die Werke, der zwar nirgends tiefer schürft, aber die Leistung des Dichters immerhin deutlich werden läßt.
Grabbe neigte zu Mystifikationen und Selbstinszenierungen. Kaum je hat er andere in sein Inneres blicken lassen, seine Absichten oft verschleiert und wohl auch selbst für bare Münze genommen, was er anderen vorgaukelte. Die oft an ihm wahrgenommene Haltung linkischer Schroffheit und abweisenden Zynismus versteht Aufenanger wie andere Autoren als Fassade, die Grabbes verzweiflungsvolle Verletzlichkeit und ohnmächtige Enttäuschung über seinen Mißerfolg verbergen sollte. In der Regel versucht Aufenanger aber nicht, Grabbes Unfähigkeit zu einem lebensfähigen Kompromiß zwischen Wollen und Wirklichkeit mit Hilfe besonderer psychologischer Theorien zu erklären; er bescheidet sich wohlweislich mit einer behutsam angewandten Alltagspsychologie. Welche Rolle etwa nun wirklich die Tatsache gespielt hat, daß Grabbe als Sohn des Wärters am örtlichen Zuchthaus Kindheit und Jugend in der wenig erfreulichen Umgebung von Gefängnismauern und Gefangenen verbracht hat, diskutiert Aufenanger natürlich, läßt die Frage dann aber klugerweise offen.
So überzeugend seine Korrektheit und Unparteilichkeit meist sind, so regelmäßig wird die Lektüre des Buches durch einen eigentümlichen Zug beeinträchtigt, der bei einem Unglücksmenschen freilich naheliegt und den ein Kenner wie Friedrich Sengle folgerichtig als Klippe jeder Grabbe-Biographie markiert hatte: Aufenangers Buch ist getränkt vom Pathos der Anteilnahme. Bezeichnenderweise erzählt er nicht im distanzierten Präteritum, sondern rückt dem Leser mit dem reportagehaft vergegenwärtigenden Präsens auf den Leib. Immer wieder verkürzt er die Syntax zu dramatisierender Kurzsätzigkeit und betont viel zu oft, daß Grabbe wieder einmal gescheitert sei, ohne Ausweg dastehe oder nur noch so und so lange zu leben habe. Etwas mehr Abstand hätte dem Buch gutgetan, denn die atemlose Teilnahme behindert die nüchterne Diskussion vieler Lebensumstände und Entscheidungen, die zu oft nur in der Perspektive eines abermaligen Mißerfolgs dargestellt werden.
Es sind nur Nuancen, aber immer wieder kippt Aufenangers Darstellung in unterschwellige Schuldzuweisungen an die anderen um, die mit Grabbe zu tun hatten: "Schon in der Schulzeit hatte Grabbe versucht, sich durch Liederlichkeit in den Mittelpunkt zu schieben, weil er eben weiß, anders kann er kein Aufsehen erregen." Wirklich? Aufsehen hatte er doch mindestens genauso durch seine vorzüglichen schulischen Leistungen erregt, die ihm sowohl das Wohlwollen des Archivrats Clostermeier sicherten als auch ein Stipendium des Detmolder Hofes. Weshalb also das flegelhafte Benehmen? Oder: Ludwig Tieck hatte für Grabbe getan, was irgendein dreißig Jahre Älterer für einen begabten, aber unfertigen, seelisch offenbar instabilen, kompromißunfähigen jungen Dichter tun kann. Aufenanger erkennt das zwar an, greift dann aber doch zu sachlich zweifelhaften, unangenehm pauschalen und darin tendenziösen Formulierungen: Tieck habe Grabbes monströsen Erstling "Herzog Theodor von Gothland" nicht aufführen wollen, weil er "in der romantisch heilen Welt der Vergangenheit zu Hause" gewesen sei. Und das Dresdner Theater habe Grabbe damit gedemütigt, daß es ihn auf Tiecks Fürsprache hin mit Geld und Freikarten über Wasser hielt - anstatt den gänzlich Unbegabten als Schauspieler auftreten zu lassen. Gar nicht gut wirkt es in Aufenangers Darstellung auch, daß die Detmolder Regierung dem gesundheitlich ruinierten Grabbe 1834 eine Dichterpension verweigerte, die er von ihr verlangt hatte; daß sie ein paar Jahre vorher das Risiko eingegangen war, Grabbe eine nicht schlecht bezahlte Stelle als Justizbeamter zu geben, dafür findet Aufenanger keine Worte der Anerkennung.
Wahrscheinlich unabsichtlich vergibt der Autor zu oft die Chance, das grundsätzliche biographische Problem des Mißverhältnisses des psychisch gefährdeten Hochbegabten und seiner widerstreitenden Umgebung so perspektivenreich darzustellen, wie es nötig wäre. Trotz der Verdienste von Aufenangers engagiertem Porträt bleibt die große kritische Grabbe-Biographie weiterhin ein Desiderat.
MATTHIAS RICHTER
Jörg Aufenanger: "Das Lachen der Verzweiflung". Grabbe. Ein Leben. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2001. 282 S., geb., 46,94 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Rolf-Bernhard Essig bespricht in einer Doppelrezension zwei Biografien deutscher Dramatiker, wobei ihm nur eine wirklich gefallen hat.
1. Willi Jasper: "Lessing. Aufklärer und Judenfreund"
Diese Biografie Lessings kann der Rezensent gar nicht genug loben, zumal zu seiner Überraschung die von ihm als Gegensatzpaar begriffene Frische und philologische Korrektheit sich in der Darstellung durchaus die Hand reichen. Er preist den "gewinnenden Stil" des Autors, der "eigene Forschungsergebnisse" aufzuweisen habe und bescheinigt dieser Lebensbeschreibung, sowohl auf der "Höhe der Zeit" zu sein, als auch ihrem Gegenstand völlig gerecht zu werden. Lediglich "Kleinigkeiten" wie den Titel und kleinere "Fehlurteile" kritisiert er, doch die können seiner Begeisterung keinen Abbruch tun.
2. Jörg Aufenanger: "Das Lachen der Verzweiflung. Grabbe. Ein Leben"
Weniger glücklich ist der Rezensent mit der Biografie Grabbes. Zwar äußert er Verständnis für die Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens, denn gesicherte Fakten zu Grabbes Leben sind rar. Er kann also nachvollziehen, dass Aufenanger auf "Spekulationen" angewiesen war, doch stört es ihn, dass der Autor sich allzu sehr von seinem Forschungsobjekt "einnehmen" lässt, was bis in die Sprache Aufenangers wirke. Ein bisschen weniger "Empathie" hätten dem Buch gut getan, meint der Rezensent, der insgesamt die "Einseitigkeit" und Parteilichkeit des Biografen beklagt.
© Perlentaucher Medien GmbH
1. Willi Jasper: "Lessing. Aufklärer und Judenfreund"
Diese Biografie Lessings kann der Rezensent gar nicht genug loben, zumal zu seiner Überraschung die von ihm als Gegensatzpaar begriffene Frische und philologische Korrektheit sich in der Darstellung durchaus die Hand reichen. Er preist den "gewinnenden Stil" des Autors, der "eigene Forschungsergebnisse" aufzuweisen habe und bescheinigt dieser Lebensbeschreibung, sowohl auf der "Höhe der Zeit" zu sein, als auch ihrem Gegenstand völlig gerecht zu werden. Lediglich "Kleinigkeiten" wie den Titel und kleinere "Fehlurteile" kritisiert er, doch die können seiner Begeisterung keinen Abbruch tun.
2. Jörg Aufenanger: "Das Lachen der Verzweiflung. Grabbe. Ein Leben"
Weniger glücklich ist der Rezensent mit der Biografie Grabbes. Zwar äußert er Verständnis für die Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens, denn gesicherte Fakten zu Grabbes Leben sind rar. Er kann also nachvollziehen, dass Aufenanger auf "Spekulationen" angewiesen war, doch stört es ihn, dass der Autor sich allzu sehr von seinem Forschungsobjekt "einnehmen" lässt, was bis in die Sprache Aufenangers wirke. Ein bisschen weniger "Empathie" hätten dem Buch gut getan, meint der Rezensent, der insgesamt die "Einseitigkeit" und Parteilichkeit des Biografen beklagt.
© Perlentaucher Medien GmbH