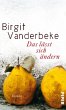Nicht lieferbar
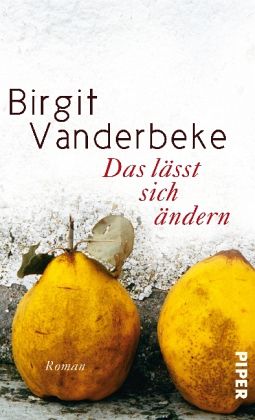
Das lässt sich ändern
Roman
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Natürlich war Adam Czupek nicht der Richtige für sie. Ein Mann, der mit den Händen arbeitete, einer, der Sprache für unwichtig hielt. Mit so einem Mann konnte man sich nicht sehen lassen, viel weniger noch sein Leben mit ihm verbringen. Dachten ihre Eltern. Aber was wussten sie, deren Ehe längst am Ende war, schon von der Liebe. Was wussten sie von Adam? Er baute Drachen für die Kinder, die sie bekamen, fand eine größere Wohnung. Das Leben wurde zum Abenteuer, als sie rauszogen aufs Land. Und als sie von Bauer Holzapfel die Streuobstwiese bekamen, hatte Adam schon längst einen Plan, w...
Natürlich war Adam Czupek nicht der Richtige für sie. Ein Mann, der mit den Händen arbeitete, einer, der Sprache für unwichtig hielt. Mit so einem Mann konnte man sich nicht sehen lassen, viel weniger noch sein Leben mit ihm verbringen. Dachten ihre Eltern. Aber was wussten sie, deren Ehe längst am Ende war, schon von der Liebe. Was wussten sie von Adam? Er baute Drachen für die Kinder, die sie bekamen, fand eine größere Wohnung. Das Leben wurde zum Abenteuer, als sie rauszogen aufs Land. Und als sie von Bauer Holzapfel die Streuobstwiese bekamen, hatte Adam schon längst einen Plan, wohin das alles führen sollte. Birgit Vanderbekes unkonventionelle Erzählerin lässt sich von Adam bezaubern und von seiner Art, das Leben anzugehen. "Das lässt sich ändern" ist ein klarer, leuchtender Roman über die Liebe, das Anderssein und über das Bekenntnis zu den einfachen Dingen.