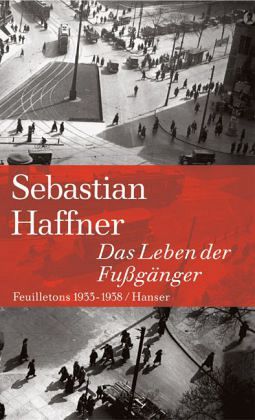"Das reine Lesevergnügen... Diese Sammlung von Feuilletons, zeigt einmal mehr die glänzende Feder dieses journalistisch-essayistischen Jungtalents. Haffner beweist eine hoch empfindliche Witterung für Abenteuer und Mythen des Alltags, für die Lüfte und Lüste des großstädtischen Zeitgeists. Dem jetzt in der Auswahl seines Feuilletons zu folgen, ist das reine Lesevergnügen. Ein Glücksfall von Buch." Peter von Becker, Der Tagesspiegel, 14.02.04 "Hier schreibt kein seriöser Kulturhistoriker, sondern ein historischer Belletrist mit dem Willen zur dramatischen Pointe... Ein Meister der kleinen Form." Stephan Schlak, Süddeutsche Zeitung, 16.03.04 "Eine der schönsten Entdeckungen des Bücherfrühlings." Die Zeit, 07.04.04 "Haffner bewies schon früh
eine außergewöhnliche literarische Begabung... Beeindruckend ist Haffners Fähigkeit, auch scheinbar nebensächliche Phänomene der Zeit zu erfassen und ebenso ironisch wie pointiert zu beschreiben. Reinhard Mohr, Der Spiegel, 22.03.04 "Ein erstaunlich stilsicherer, scharf beobachtender Autor - ein Meister der kleinen Form. Der Ton erinnert an die großen Berliner Feuilletonisten, an Alfred Kehr, Victor Aubertin, Franz Hessel, Walther Kiaulehn... Haffner-Liebhabern bieten dies Kostproben die reizvolle Möglichkeit, bereits bestimmte Züge und Eigenarten zu entdecken, die den späteren großen politischen Journalisten und begnadeten Historiker auszeichnen sollten, so vor allem seine Lust an der brillanten Pointe und originellen These... Die "Geschichte eines Deutschen", dieser Geniestreich des gerade 31-Jährigen, kam nicht aus heiterem Himmel; er war vorbereitet worden in diesen wunderbaren kleinen listigen Harmlosigkeiten, deren Lektüre noch heute großen Genuss bietet." Volker Ullrich, Die Zeit, 07.04.04 "Ein Buch, wie ein sinnlicher Bummel über einen Trödelmarkt..." Ralf Hanselle, Rheinischer Merkur, 11.03.04 "Ein Flaneur zu allen Jahreszeiten; ein Mann fürs Feine und Kuriose, dessen Prosa durch die Themen streift, ohne sie analytisch zu beschweren; Humor noch da wo die Seele den Gegenwind der Diktatur erfährt." Martin Meyer, Neue Zürcher Zeitung, 27./28.03.04 "Ein Lesegenuss: die tägliche Entstehung der Welt aus unseren Sinnen und Träumen... In Haffners frühen Texten lebt, ganz wunderbar, das Opfer aller Politik und Geschichte: Die Leichtigkeit des Seins. Hans-Dieter Schütt, Neues Deutschland, 25.04.04