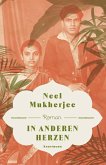Was geschieht, wenn wir versuchen, das Leben, in dem wir zu Hause sind, für etwas Besseres zu verlassen? In fünf Schicksalen entfaltet sich in diesem Roman ein grandioses Panorama der modernen indischen Gesellschaft. Neel Mukherjee erzählt in Das Leben in einem Atemzug von Menschen, die aufbrechen, ihr Zuhause verlassen, um für sich und ihre Familien ein besseres Leben zu erlangen. Da ist die Köchin in Mumbai, die in sechs Haushalten kocht; da ist der Mann, der mit seinem Tanzbär von Ort zu Ort zieht, da ist das Mädchen, das vor den Terroristen, die ihr Dorf bedrohen, in die Stadt flieht - sie alle erleben, was es bedeutet, nicht mehr im eigenen, vertrauten Umfeld zu sein. Ihre Schicksale erzählen von den Frösten der Freiheit, vom Fremd- und Alleinsein, von Armut und Arbeit. Aber auch von der Hoffnung und Glück. Ein atmosphärisch dichter Roman aus dem heutigen Indien, einer modernen Gesellschaft, in der die Schatten einer anderen noch deutlich spürbar sind. Leidenschaftlich und voller Empathie entfaltet sich in einem Reigen von Geschichten das unstillbare menschliche Streben nach einem anderen, besseren Leben.

Neel Mukherjee erzählt von der Rückkehr indischer Auswanderer und Studenten in ihre Heimat
Woher kommt die Wut dieses knapp fünfzigjährigen Schriftstellers aus Kalkutta, der in England studiert hat und seit langem in London wohnt? Er starrt auf seine, die indische, Gesellschaft mit einer geradezu manischen Sucht, das Schwarze, das Hässliche, das Grausame und das Elend zu beschreiben. Er bestätigt dabei, was Auslandsinder im Allgemeinen gern verheimlichen oder beschönigen wollen, nämlich dass in ihrem Heimatland eine riesige Menschenzahl weiterhin in Ungerechtigkeit und Armut lebt. Neel Mukherjee gibt dieser Sichtweise mit seinen Romanen den Stempel der Authentizität, denn der bohrende Realismus seiner Beschreibungen lässt keinen Zweifel zu: Sie sind keineswegs Auswürfe einer sadistischen Phantasie, sondern Ergebnis genauer Beobachtungen.
In seinem letzten Roman, auf deutsch "In anderen Herzen", beschrieb er das Leben einer Großfamilie in Kalkutta (F.A.Z. vom 13. April 2016) mit demselben harten, vielleicht bösen, Blick für die kleinen Grausamkeiten des alltäglichen Lebens. Immerhin gab es zum Schluss eine positive Figur, einen begabten Jungen, dem es gelingt, sich den Fangarmen der Familie zu entwinden und in Amerika eine Existenz aufzubauen. Im neuen Roman von Mukherjee findet sich ein solcher Lichtblick nur auf den letzten dreißig Seiten des vierten Abschnitts. Binay rettet da die Hausangestellte Milly, die von der Familie in Bombay, für die sie arbeitet, in deren Wohnung gefangen gehalten wird. Die beiden heiraten und beginnen in einem Slum ein entbehrungsreiches, aber immerhin sinnvolles Leben, das vor allem den Ausblick auf eine bessere Zukunft ihrer Kinder zulässt. Bleibt von der "modernen indischen Gesellschaft", die der Klappentext verspricht, nur dieser dünne Lichtblick?
Mukherjees Buch besteht aus fünf numerierten Erzählungen, die keinen Bezug zueinander haben, im Grunde ist es also gar kein Roman. Nur Milly taucht in "Zwei" und in "Vier" auf. Der erste Teil beschreibt die Bemühung eines indischen Vaters, der in Amerika wohnt, seinem Sohn den Taj Mahal und andere historische Gebäude in Agra zu erklären. Seine Gespaltenheit zwischen der Erinnerung an die Jugend in Kalkutta und den Ansprüchen des wohlhabenden Auslandsinders lässt ihn zu "einem Touristen in seinem eigenen Land" werden. Vater und Sohn werden ängstlich, als ein Unbekannter sie verfolgt. Die Bedrohung erschüttert den Jungen so heftig, dass er stirbt.
Die Kapitel zwei bis vier sind Kurzromane aus unterschiedlichen Milieus. In "Zwei", in einem Haushalt der Mittelschicht angesiedelt, dreht es sich ums gute Essen. Der Sohn, der in London arbeitet, kehrt zu seinen Eltern nach Bombay zurück, die ihn verwöhnen. Milly und Renu, die beiden Köchinnen, tragen einen zänkischen Wettstreit miteinander aus, wer den Ansprüchen des Sohnes besser genüge. Die Klassenunterschiede, die Arroganz der "Herrschaft", die Ausbeutung des Personals, die Bemühungen des Sohnes, der "westlich" empfindet, um Wahrung von Menschenwürde und eines freundlichen Umgangstons - die Mutter nennt es "Gleichheitsquatsch" - diese Themen werden durchdekliniert, ohne dass sich eine menschliche Entwicklung abzeichnet.
Kapitel drei spielt in einem armen Dorf des Himalaja. Dorthin hat sich ein Bärenjunges verirrt, das der Bauer Lakshman aufzieht in der Hoffnung, es zum Tanzbär abzurichten und so eine Menge Geld zu verdienen. Mukherjee beschreibt, wie sich der Frust über die ausweglose Armut in gewalttätiger Grausamkeit gegenüber dem Tier, der Frau und ihren Kindern entlädt. Die Erzählung mäandert unstrukturiert von einer Verbitterung zur anderen. Als der Bär schließlich ein paar Scheine Verdienst einbringt, verwandelt ein prasselnder Regen sie zu Brei.
Das vierte Kapitel, literarisch das bemerkenswerteste, führt in das von maoistischen Untergrundkämpfern verunsicherte Milieu eines mittelindischen Dorfes. Der Autor kennt sich aus: Die Operationen der Milizen sind genau dargestellt. Von den beiden Freundinnen Milly und Soni schließt sich die Letztere der "Partei" an, während Milly den Ausweg zu den Haushalten der Reichen sucht, sich ausbeuten, schlagen und erniedrigen lässt, bis sie ihren Befreier Binay findet. Das knappe fünfte Kapitel, in Stil und Inhalt isoliert, meditiert in einer Art innerem Monolog die existentielle, trostlose Lebenssituation eines Arbeiters.
In dem früheren Roman waren die Präzision der Sprache wie auch der Übersetzung bemerkenswert. Im neuen Buch dagegen bleiben viele Passagen schwammig. Immer wieder gleitet die Sprache ohne Zweck auf die Ebene des Umgangstons ab und begnügt sich mit Füllwörtern. Die Übersetzung leistet sich Schnitzer wie "das hoffnungslose Los" oder "altbackene chapati", wenn vertrocknete chapati (Brotfladen) gemeint sind.
Wem kann man das Buch empfehlen? Wer emotionale Verhärtung und Niedertracht studieren möchte, wird reichlich Material finden. Wer die Dynamik menschlicher Entwicklungen sucht, ist enttäuscht.
MARTIN KÄMPCHEN
Neel Mukherjee: "Das
Leben in einem Atemzug".
Roman.
Aus dem Englischen von
Giovanni und Ditte Bandini.
Verlag Antje Kunstmann, München 2018. 348 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Shirin Sojitrawalla ärgert sich über den kitschigen Titel. Dahinter verbirgt sich nämlich kein indisches Epos, sondern harte Gesellschaftskritik, so Sojitrawalla über Neel Mukherjees episodisch angelegten Roman. Was sich als Tourist im eigenen Land erleben lässt, erzählt der Autor laut Sojitrawalla ohne Schönfärberei, realistisch, drastisch mit vielen Perspektivwechseln und bildreicher Sprache für die menschenverachtende Ungleichheit in der indischen Lebenswirklichkeit. Schade findet Sojitrawalla, dass die einzelnen Episoden sich nicht geschmeidig verbinden und der Stil des Ganzen nicht der raffinierteste ist.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH