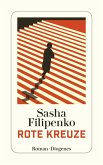Ein Erzähler, durch aktuelle Erinnerungslücken beunruhigt, findet einen ungewöhnlichen Ausweg, dem vorstellbar gewordenen Verlust des Gedächtnisses zu begegnen. Er «verteilt» die wichtigsten seiner Erlebnisse mündlich und in Briefen an seine Freunde. Eines Tages, so sein Auftrag, wenn ihm gewisse Details der eigenen Biographie nicht mehr zur Verfügung stehen, sollen ihm die Freunde seine Erinnerungen «zurückerzählen».

Wilhelm Genazinos neuer Spaziergang / Von Sabine Brandt
Wilhelm Genazino schreibt Bücher, die beunruhigen. Es ist nicht die Handlung, die einen solchen Eindruck erzeugt, weil nämlich der Autor mit dieser literarischen Kategorie sparsamen Umgang pflegt. Er erzählt keine Geschichten. Offenkundig mißtraut Genazino dem Realitätswert dessen, was Handlungen trägt und vorantreibt, Liebe und Haß, Verbrechen und Edeltat, Unternehmung und Scheitern. Wo, so scheint er zu fragen, ist das universale Gesetz, nach dem derlei funktioniert? Gibt es aber keines, so ist Tun oder Lassen nichts als die Resultante willkürlich wirkender Kräfte und biologischer Zufälle.
Genazino stellt also Übereinkünfte in Frage, die seit Vorzeiten dazu dienen, das Chaos zu ordnen und dem Dasein Sinn zu geben. Das heißt, er zieht uns den Boden unter den Füßen weg. Es ist ungefähr so, als mache jemand den blauen Himmel verschwinden, der die Erde so wohltuend von der Unendlichkeit abschottet und unseren Sinnen vorspiegelt, was allein sie fassen können, die dreidimensionale Endlichkeit. Sobald sich unbarmherzig das schwarze Universum dehnt, schrumpfen wir zu Stäubchen. Was gilt, unter solchen Auspizien, unser Sein oder Nichtsein, unser umtriebiges Hin und Her?
Genazino hat sich darauf kapriziert, die Wirkung der Bodenlosigkeit auf den Menschen zu untersuchen. Er macht aus den Figuren, die er solcher Beklemmung aussetzt, keine Philosophen, die ihre Welt durchdenken und Thesen über sie aufstellen. Vielmehr zeigt er Leute vom Dutzend, beladen mit Verwirrung und Depression, deren Art und Herkunft sie nicht kennen. Schauplatz ihrer unbegriffenen Leiden ist vorwiegend die Großstadt, wie es sich fast von selbst versteht, denn die steinernen Moloche haben, seit es sie gibt, als Sinnbilder für Entpersönlichung herhalten müssen. Zudem kennt Genazino, 1943 in Mannheim geboren, ansässig in Frankfurt am Main, von allen Daseinsformen das Großstadtleben am besten.
Die bekannteste seiner Figuren, Held dreier von neun Romanen, heißt Abschaffel und ist Angestellter in einer großstädtischen Speditionsfirma. Diese seine Angestelltenexistenz nennt Abschaffel "einen monströsen Unsinn". Genauso hätten die nach ihm geschaffenen Figuren ihre Lage bezeichnen können, wenngleich der Autor sich allmählich von den Büroknechten ab- und dem eigenen Milieu zuwandte. In den späteren Büchern, darunter drei ohne literarischen Gattungsbegriff, wird zwar wenig Wert auf genaue Berufsbezeichnungen und -umgebungen gelegt, doch drängt das Ambiente den Eindruck auf, hier agiere ein freischaffender Schreibender.
Das gilt auch für die jüngste Arbeit, die jetzt unter dem Titel "Das Licht brennt ein Loch in den Tag" erschienen ist. Über ihre Hauptfigur, dem Leser nur mit dem Kürzel "W." präsentiert, erfährt man vielerlei, nichts jedoch darüber, ob und was W. arbeitet. Da er aber einerseits kein Krösus ist, andererseits nicht am Hungertuch nagt, wird er schon irgendeinen Brotberuf haben, und zwar einen, dessen Stundenplan er selber festsetzen kann. W. hat also Zeit, über sich zu grübeln und sich als gefährdet zu entdecken. Die Gefährdung ist nicht materieller, sonder spiritueller Natur. Soll heißen, daß W. seine Existenz, je länger, desto mehr, als sinnlos empfindet und alles um sich herum als fragwürdig. Das einzig Konkrete unter lauter Schimären scheint ihm die Erinnerung zu sein, der Schatz an gelebtem Leben, den das Gedächtnis aufbewahrt.
Aber sein Hirn, das den Tresor für diesen Schatz abgeben muß, ist nichts als ein fragiler Molekülhaufen ohne Ewigkeitswert. Schon ein einfaches Vergessen wird W. vernichten. Er notiert: "Schon oft dachte ich, es ist nichts als die Vorarbeit des Todes, die uns die Erinnerungen nimmt, eine Art Ouvertüre, die mit dem Leichtesten beginnt, mit der Auflösung des Gedächtnisses. Diese Vernichtung ist nicht ohne Logik, je weniger wir aufbewahren, desto notwendiger erscheint uns das Verschwinden. Aber es ist nicht der Tod, im Gegenteil, es ist etwas Lebendiges und Unaufhörliches: Es ist die von uns immer wieder hinausgeschobene Entscheidung, ob wir uns zu leben trauen sollen oder nicht, und während wir den Entschluß immer wieder verzögern, haben wir erneut ein Stück weitergelebt, undeutlich und ein bißchen unfreiwillig wie meistens."
W. hat sich entschlossen, seine Erinnerungen an seine Freunde zu verteilen. Er legt sozusagen Depots an, die ihm zur Verfügung stehen sollen, wenn die Amnesie über ihn kommt. Er hält fest, was sich irgendwann einmal mit ihm und um ihn zutrug, wenig Bedeutendes, viel Belangloses, wie es eben so ist in eines Menschen Alltag. Es geht ihm ja nicht darum, sich ein Denkmal zu setzen, sondern darum, sich am Leben zu halten. Am Leben ist er, solange er identisch bleiben kann mit seinen Geschichten. Er ist, das sagt ihm sein Gefühl, deren Summe, sonst nichts.
W. in seinen Vorstellungen zu folgen ist ziemlich beängstigend. Zwar äußert oder tut er nichts auch nur annähernd Dramatisches. Aber sein scheinbar gleichmütiger Blick gewinnt von Brief zu Brief, von Notiz zu Notiz eine Überschärfe, wie man sie allenfalls aus Situationen äußerster Anspannung kennt, aus überwachen Momenten kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Es ist eine Art gespenstisches Doppelsehen und Dreifachwahrnehmen, als schaue man gleichzeitig mehrere Filme, übereinanderkopiert und doch jeder für sich ganz deutlich. W. ist so besessen von seiner Idee der Spurensicherung, daß er nicht vermag, sich durch Weggucken zu entspannen. Wie kann man auch vor einem Menetekel den Kopf wegdrehen?
Wofür das Menetekel steht, weiß W. nicht. Wüßte er es, dann könnte er wahrscheinlich die Welt als Zuhause und seine Identität als unbedroht empfinden. Denn auch ein tragisches Schicksal hat seinen Sinn, und im Zusammenhang damit ist selbst der Tod eine logische, daher akzeptierbare Größe. Was aber ist Tod, wenn W. aus Sinnlosigkeit geboren wurde und in Sinnlosigkeit lebte? Nichts als die letzte der Grausamkeiten ohne Ursprung, infolgedessen ohne Berufungsinstanz. Das ist es, was W.s überfeine Wahrnehmung registriert und wogegen er einen Damm aus Erinnerungsbriefen errichten will.
Ein Fall für den Psychiater? Das Buch nimmt sich tatsächlich so aus, als ließe sein Autor uns die Aussagen eines seelisch Kranken lesen. Daran wäre kein Makel, fehlte nicht etwas Wesentliches, nämlich die andere Seite des Krankenblatts, sozusagen das Wissen des Therapeuten. Man möchte wissen, wodurch W.s Seele Schaden nahm. Wenn wir ihn nicht genauer kennenlernen dürfen, müssen seine Anfechtungen uns beliebig erscheinen und mithin sehr bald langweilen. Es wäre schade um die in ihren Einzelheiten feine literarische Arbeit.
Wagen wir darum die Gesamtdeutung, die das Buch vermissen läßt: W. ist das Produkt einer Gesellschaft, der die Überzeugungen der Väter verlorengingen. Zwei Weltkriege und das viele weitere blutige Unrecht in diesem Jahrhundert haben die überlieferten Werte desavouiert. Unsere Gegenwart scheint satt, ist aber ohne Glauben und Tröstungen. Wie sollte das nicht Angst erzeugen? Genazinos Buch der versuchten Erinnerungen ist ein Protokoll dieser Angst.
Wilhelm Genazino: "Das Licht brennt ein Loch in den Tag". Rowohlt Verlag, Reinbek 1996. 126 S., geb., 34,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Viele dieser kurzen Erzählungen des Buches möchte man wieder und wieder lesen, um sie zu Teilen eigener Erinnerungen umzubauen. Süddeutsche Zeitung