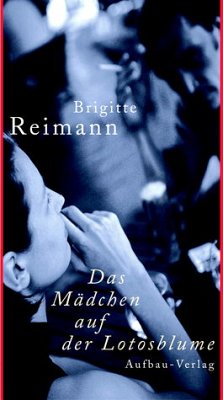"Zwei weitere Manuskripte sind mir abgelehnt: Wenn die Stunde ist, zu sprechen war konterrevolutionär (...). Das zweite, Joe und das Mädchen auf der Lotosblume, kam ebenfalls zurück, etikettiert mit Bemerkungen wie: dekadent, morbid, skurril etc. Ich hatte es mir nicht versagen können, in einem als Liebesgeschichte getarnten Buch politische oder allgemein weltanschauliche Ungezogenheiten zu begehen."
(Brigitte Reimann am 25. 9. 1957)
Ein glücklicher Zufall hat vor kurzem diese zwei Romanprojekte auftauchen lassen, die Brigitte Reimanns früh ausgeprägtes Erzähltalent und ihren unbestechlichen Blick belegen. Beide Romane wurden damals von den Verlagen abgelehnt - weil sie politische Tabus ignorierten oder als westlich-dekadent beeinflußt galten -, von der Autorin aufgegeben und vergessen. Jetzt werden sie erstmals publiziert.
Brigitte Reimann war gerade zwanzig, als sie einen Roman zu schreiben begann, dessen politische Brisanz erstaunlich ist für die frühe DDR-Literatur. Angesiedelt im Schulmilieu, ging es in Wenn die Stunde ist, zu sprechen ... um die willkürliche Verhaftung eines Halbwüchsigen durch die Staatssicherheit, um Schüler, die in die FDJ gezwungen wurden, um reaktionäre Lehrer. Im Zentrum stand ein attraktives, aber verbohrtes Mädchen, dem durch eine Liebesgeschichte die Augen geöffnet wurden. Bereits in jenem sinnlichen Stil, den die Autorin erst in Franziska Linkerhand wiederfand, ist dann der wenig später entstandene kleine Roman Joe und das Mädchen auf der Lotosblume erzählt: die Dreiecksbeziehung einer jungen, kapriziösen Malerin, die weder in der Liebe noch in der Kunst Kompromisse akzeptiert.
(Brigitte Reimann am 25. 9. 1957)
Ein glücklicher Zufall hat vor kurzem diese zwei Romanprojekte auftauchen lassen, die Brigitte Reimanns früh ausgeprägtes Erzähltalent und ihren unbestechlichen Blick belegen. Beide Romane wurden damals von den Verlagen abgelehnt - weil sie politische Tabus ignorierten oder als westlich-dekadent beeinflußt galten -, von der Autorin aufgegeben und vergessen. Jetzt werden sie erstmals publiziert.
Brigitte Reimann war gerade zwanzig, als sie einen Roman zu schreiben begann, dessen politische Brisanz erstaunlich ist für die frühe DDR-Literatur. Angesiedelt im Schulmilieu, ging es in Wenn die Stunde ist, zu sprechen ... um die willkürliche Verhaftung eines Halbwüchsigen durch die Staatssicherheit, um Schüler, die in die FDJ gezwungen wurden, um reaktionäre Lehrer. Im Zentrum stand ein attraktives, aber verbohrtes Mädchen, dem durch eine Liebesgeschichte die Augen geöffnet wurden. Bereits in jenem sinnlichen Stil, den die Autorin erst in Franziska Linkerhand wiederfand, ist dann der wenig später entstandene kleine Roman Joe und das Mädchen auf der Lotosblume erzählt: die Dreiecksbeziehung einer jungen, kapriziösen Malerin, die weder in der Liebe noch in der Kunst Kompromisse akzeptiert.

Zwei frühe Romane Brigitte Reimanns / Von Jörg Magenau
Nein, es war nicht alles schlecht. Zum Beispiel die Schriftstellererholungsheime. Dort versammelten sich all die, die mit ein paar Gedichten pro Jahr ein ordentliches Auskommen fanden, denn Kunst und Geist waren hoch subventioniert in einer Gesellschaft, die ihre Güter nicht als Waren auf den Markt schickte. In den Schriftstellererholungsheimen der DDR wurde nicht nur viel getrunken, sondern auch exzessiv geflirtet, und dann verliebten sich die anwesenden Männer in Brigitte Reimann. Reimann, weit und breit die einzige in Frage kommende Frau, notierte im Herbst 1956 in ihrem Tagebuch, sie habe noch keinen älteren Mann getroffen, der sie nicht für ein "relativ unschuldiges, natürliches kleines Mädchen hielte und demgemäß behandelte. Keiner will mir glauben, daß ich ein Abgrund (huch!) bin . . ."
Dreiundzwanzig Jahre alt, seit drei Jahren verheiratet, besuchte sie damals ein Autorenseminar der Defa im "Lieselotte-Hermann-Heim" in Sacrow. Sie verliebte sich in den Dramaturgen Wolfgang Ebeling und überlegte, ihn zu heiraten, weil bei ihr jede Liebe tendenziell in einen Ehewunsch mündete. Zwei Tage später begegnete sie dem Schriftsteller und Funktionär Max Walter Schulz, zärtlich "Joe" genannt. Große Liebe. Schließlich tauchte der Schriftsteller Herbert Nachbar auf und so weiter. Erstaunlicherweise führte Brigitte Reimann all ihre Amouren im Glauben, sie seien einzigartig, groß und ewig. Das mußte zu Komplikationen führen und erforderte literarische Bewältigung.
Reimann schrieb sich ihre Sacrower Liebesverwicklungen in dem kleinen Roman "Joe und das Mädchen auf der Lotosblume" von der Seele. Fertig wurde sie damit nicht; sie brach die Arbeit ab, als der Verlag Neues Leben ihren Entwurf als "dekadent, morbid, skurril" ablehnte. Im Tagebuch notierte sie: "Ich hatte es mir nicht versagen können, in einem als Liebesgeschichte getarnten Buch politische oder allgemein weltanschauliche Ungezogenheiten zu begehen." Symptomatisch ist der Begriff "Ungezogenheit", mit dem Reimann ihre politischen und ästhetischen Empfindungen auf die kindliche Trotzebene zerrt. Sie ist sich in ihrem emotionalen Aufbegehren keineswegs sicher. Die Vernunft spricht für die patriarchale sozialistische Gesellschaft mit ihren autoritären Herren, die verkünden, wo es langgeht zum Paradies auf Erden. Und doch läßt sie ihr Alter ego, das Mädchen Maria, zu einem etwas älteren, linientreuen Arbeiterschriftsteller sagen: "Dein Sozialismus ist ein Arbeitshaus, in dem Traktoren rattern und Drehbänke kreischen und alles nach ,Leistungssteigerung' schreit; ein Arbeitshaus, hörst du, in dem keine Blumen blühen und keine Musik klingt . . ."
Kurz darauf bricht das Manuskript ab. Vielleicht wurde der Autorin klar, daß sie sich in eine Deutlichkeit hineingeschrieben hatte, die den Text für die DDR unmöglich machte. Vielleicht hat sie in der zunehmenden Konfusion aber auch nur die Orientierung verloren. Es war die Zeit nach der Niederschlagung des Ungarnaufstandes, als Walter Janka, Gustav Just, Wolfgang Harich, Erich Loest und andere sogenannte Konterrevolutionäre verhaftet und in Schauprozessen zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Da war es mehr als ein Risiko, sich über sozialistische Plakat-Kunstfiguren mit "Chlorodontlächeln und Proletarierfäusten" zu mokieren, und Reimann kann wohl noch von Glück sagen, daß ihr die Manuskripte einfach nur zurückgeschickt wurden. Es sind weniger die Details - die sich im Zweifelsfall ja hätten streichen lassen -, die den Roman unmöglich machten, als die vitale Grundhaltung einer Frau, die sich nicht domestizieren lassen wollte. Eine so starke, auch noch in Ich-Form vorgetragene Subjektivität mußte aller kollektiven Moral und verordneten historischen Notwendigkeit zuwiderlaufen, selbst dann, wenn die Autorin sich zum Sozialismus bekannte und versuchte, ihr Manuskript einigermaßen stromlinienförmig zu machen.
Noch erstaunlicher ist eine zweite damals abgewiesene Erzählung, an der Reimann von 1952 bis 1957 immer wieder gearbeitet hat. Sie hieß zunächst "Die Denunziantin" und erhielt nach mehreren grundlegenden Überarbeitungen schließlich den an Hemingway erinnernden Titel "Wenn die Stunde ist, zu sprechen". Withold Bonner erzählt in einem aufschlußreichen Nachwort die Entstehungsgeschichte. Demnach haben sich Intention und Erzählperspektive im Lauf der Jahre geradezu umgekehrt. Handelte die Geschichte zunächst von einer schönen, musterhaften FDJlerin, die einen Lehrer denunzierte und am Ende auch ihre Mitschüler von der Richtigkeit ihres Tuns überzeugte, so ist in der Endfassung ein politisch eher unzuverlässiger Mitschüler die Hauptfigur. Er verliebt sich in die FDJlerin und setzt bei ihr einen Prozeß der leisen Verunsicherung in Gang. Ende offen, denn das Manuskript bricht nach sechs Kapiteln ab.
Dem Fragment läßt sich ablesen, wie die junge Autorin allmählich ihre feste sozialistische Position verlor und die Zweifel an der Berechtigung des durch Antifaschismus legitimierten Systems zunahmen. Auslöser dafür war die Verhaftung eines Mitschülers von Brigitte Reimann im Jahr 1950, ein Erlebnis, auf das sie, weil sie damit nicht fertig wurde, literarisch zurückkommen mußte. Respektlose Schüler, die das Vergnügen höher stellen als die politische Arbeit, ein schwächlicher Direktor, der die Schüler erpresserisch in die FDJ zwingt, reaktionäre Lehrer, versagende Eltern und Antifaschisten, die den Bezug zur Jugend längst verloren haben, waren als Stoff einer Erzählung zwar realistisch, entsprachen aber nicht dem, was die Hüter des sozialistischen Realismus unter Wirklichkeit verstanden wissen wollten. Daß diese Erzählung keine Chance haben würde, war klar. In der ersten Fassung, die Reimann in diversen Schreibkursen vortrug, war ihr dagegen noch "Linksradikalismus" vorgeworfen worden. Da erschien der Text sogar den Verfechtern der reinen Lehre allzu eindimensional und tugendhaft.
Die Fragmente, von der Autorin 1957 nach der Ablehnung vergraben und vergessen, fanden sich auf dem heimischen Dachboden wieder. Reimanns Schwester gab sie zum Reimann-Archiv nach Neubrandenburg, im Aufbau-Verlag sind "Joe und das Mädchen auf der Lotosblume" und "Wenn die Stunde ist, zu sprechen" nun mit fast fünfzigjähriger Verspätung erschienen. Beide Texte, so unterschiedlich sie von Tonlage und Sujet her auch sind, haben sich über die Zeit hinweg eine erstaunliche Jugendlichkeit bewahrt.
Stilistisch unausgegoren schwanken sie zwischen sentimentalischer Ergriffenheit und der sogenannten "harten Schreibweise" hemingwayscher Prägung. Sie wirken keineswegs altbacken, obwohl doch die Koordinaten einer kleinbürgerlichen Moral und sozialistischer Geradlinigkeit, zwischen denen der Stoff kaum unterzubringen ist, ihre Gültigkeit verloren haben. Doch gerade dadurch wird die banale Dreiecksgeschichte ebenso wie die Geschichte der Denunziation zum historischen Lehrstück, das etwas über die Ängste und Sehnsüchte einer untergegangenen Gesellschaft erzählen kann. Im Westen, ohne politische Drangsalierung, wäre aus Reimann vermutlich eine Femme fatale geworden, deren Liebesabenteuer heute niemanden mehr interessieren würden. In der DDR wurde sie zu einer Opponentin nicht aus politischer Überzeugung, sondern aus Instinkt und Gefühlsnotwendigkeit. Daß eine bedeutende Schriftstellerin aus ihr werden würde, lassen schon diese frühen Texte ahnen.
Brigitte Reimann: "Das Mädchen auf der Lotosblume". Zwei unvollendete Romane. Aufbau-Verlag, Berlin 2003. 238 S., geb., 18,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Bislang, schreibt die Rezensentin Susanne Messmer, sah man Brigitte Reimann als eine dieser Autoren, die sich anfangs mit der DDR identifizierten, die aber zunehmend kritischer wurden. Mit dieser verkürzenden Einschätzung dürfte es jetzt wohl zuende sein, so Messmer weiter, denn die Entdeckung zweier früher (und von den Verlegern abgelehnte) Romanmanuskripte der Autorin offenbart eine Brigitte Reimann, für die es keine "Phase des ungebrochenen Glaubens" gegeben hat, und die schon seit Anbeginn mit Tabus bricht, sogar so radikal wie danach nie wieder. "Das Mädchen auf der Lotosblume", die Geschichte der Malerin Maria, die sich auf der Suche nach dem eigenen Stil an den "Scheuklappen-Dogmatikern des Sozialistischen Realismus" reibt, klingt zwar für die Rezensentin teilweise "backfischig und pennälerhaft", wird jedoch auch von dem innigen Willen getragen, "in die Welt" zu gehen. Dieses Romanfragment, lobt Messmer, erlaubt die seltene Einsicht in die Situation eine Frauengeneration, die dem Hausfrauen und Mütter ausbildenden "Bund Deutscher Mädel" angehörte und sich dann emanzipierte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Die bedeutende DDR-Schriftstellerin traf den Nerv ihrer Zeit. Allen Anfeindungen zum Trotz lebte sie wild und unangepasst. Ihre Position als Autorin nutze sie, um gesellschaftliche Probleme ebenso kritisch wie emotional zu beleuchten; sie verklärt und beschönigt nichts, schreibt schnörkellos und ohne erhobenen Zeigefinger". (Young Miss, Juli 2003)
"Statt des gestelzten Schulmädchenjargons und theoretischer Statements eine bildhafte, erlebnisintensive Sprache, genaue Beobachtungen, eine Handlung voller Ironie, Selbstironie und Witz, dazu eine behutsame Figurenzeichnung, ganz wie sie die erzählende Ich-Figur, die Malerin Maria, bevorzugt ... Dieses Fragment war auf dem besten Wege, ein politischer Roman zu werden. Die Monologe der Maria stehen denen der 'Franziska Linkerhand' in nichts nach." (Märkische Allgemeine) "Die bedeutende DDR-Schriftstellerin traf den Nerv ihrer Zeit. Allen Anfeindungen zum Trotz lebte sie wild und unangepasst. Ihre Position als Autorin nutze sie, um gesellschaftliche Probleme ebenso kritisch wie emotional zu beleuchten; sie verklärt und beschönigt nichts, schreibt schnörkellos und ohne erhobenen Zeigefinger." (Brigitte)