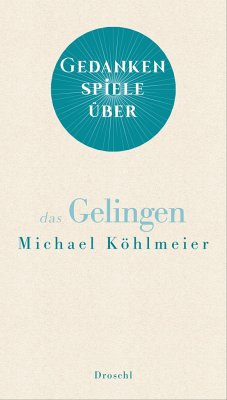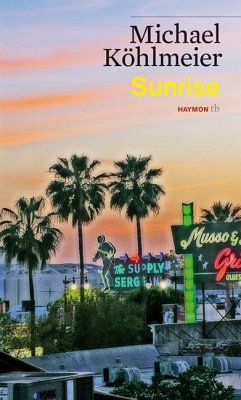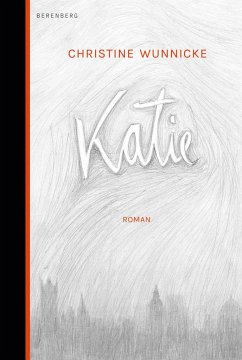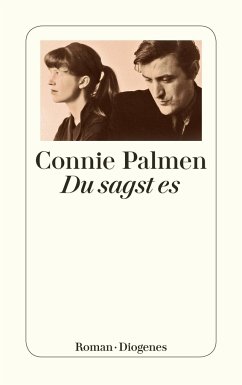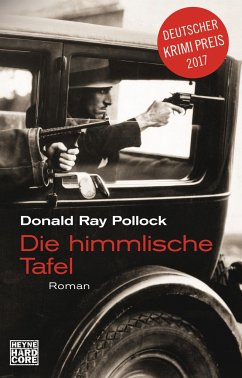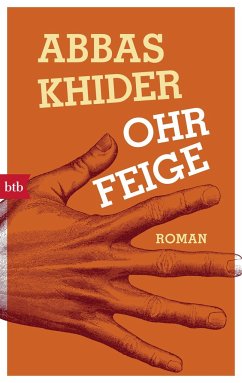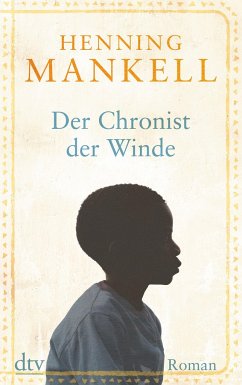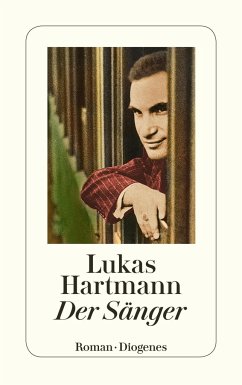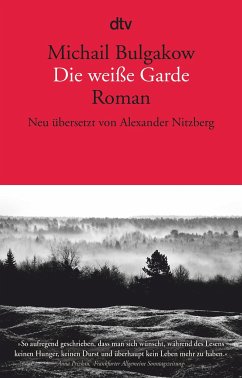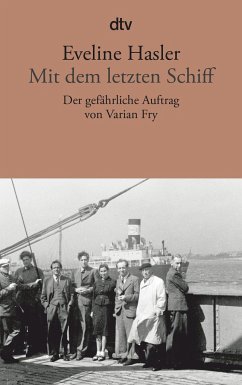Nicht lieferbar

Michael Köhlmeier
Broschiertes Buch
Das Mädchen mit dem Fingerhut
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:





Märchenhaft und berührend
Irgendwo in einer großen Stadt, in Westeuropa. Ein kleines Mädchen kommt auf den Markt, hat Hunger. Sie versteht kein Wort der Sprache, die man hier spricht. Doch wenn jemand »Polizei« sagt, beginnt sie zu schreien. Woher sie kommt? Warum sie hier ist? Wie sie heißt? Sie weiß es nicht. Michael Köhlmeier erzählt von einem Leben am Rande, von der kindlichen Kraft des Überlebens, von unserer Gegenwart.
Irgendwo in einer großen Stadt, in Westeuropa. Ein kleines Mädchen kommt auf den Markt, hat Hunger. Sie versteht kein Wort der Sprache, die man hier spricht. Doch wenn jemand »Polizei« sagt, beginnt sie zu schreien. Woher sie kommt? Warum sie hier ist? Wie sie heißt? Sie weiß es nicht. Michael Köhlmeier erzählt von einem Leben am Rande, von der kindlichen Kraft des Überlebens, von unserer Gegenwart.
Michael Köhlmeier, 1949 in Hard am Bodensee geboren, lebt in Hohenems/Vorarlberg und Wien. Er studierte Germanistik und Politologie in Marburg sowie Mathematik und Philosophie in Gießen und Frankfurt. Michael Köhlmeier schreibt Romane, Erzählungen, Hörspiele und Lieder und tritt sehr erfolgreich als Erzähler antiker und heimischer Sagenstoffe und biblischer Geschichten auf. Für seine Bücher erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den Johann-Peter-Hebel-Preis, den Manès-Sperber-Preis, das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse, den Marie-Luise-Kaschnitz-Preis für sein Gesamtwerk und den Ferdinand-Berger-Preis für sein politisches Engagement.

© Peter-Andreas Hassiepen
Produktdetails
- dtv Taschenbücher 14617
- Verlag: DTV
- 3. Aufl.
- Seitenzahl: 144
- Erscheinungstermin: 12. Januar 2018
- Deutsch
- Abmessung: 190mm x 121mm x 15mm
- Gewicht: 161g
- ISBN-13: 9783423146173
- ISBN-10: 3423146176
- Artikelnr.: 47731697
Herstellerkennzeichnung
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Tumblingerstr. 21
80337 München
www.dtv.de
+49 (089) 381670
Berührend ist dieser Roman, ein starker Text mit Aussagekraft! bookreviews.at 20190107
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Das Titelbild, also der erste Eindruck von Michael Köhlmeiers kleinem Roman "Das Mädchen mit dem Fingerhut" trügt, warnt Rezensent Hubert Winkels. Das ist kein Roman über ein erbarmungswürdiges kleines Mädchen. Es ist auch kein Märchen oder ein Flüchtlingsroman. Man könne es zwar so lesen, doch die Intensität, die Köhlmeier hier wortkarg entfaltet, bekommt man mit solchen Einordnungen nicht zu fassen, findet Winkels. Dieser Roman ist grausam. Das Mädchen und zwei andere Kinder verweigern jede Kommunikation, eine Frau, die das Kind erziehen will, wird umgebracht. Humane Integration? Wird von den Kindern nicht mal als Möglichkeit erkannt. Diese Botschaft wird noch stärker durch den super reduzierten Stil Köhlmeier, lobt Winkels. Da bleibt kein Auge trocken.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Gebundenes Buch
Das Mädchen ohne Namen und ohne Herkunft
In dieser mit 140 Seiten sehr kurzen Geschichte begleitet der Leser ein sechsjähriges Mädchen eine kurze, sehr traurige Wegstrecke seines noch jungen Lebens.
Eines Tages wird dieses Mädchen in irgendeiner, nicht näher …
Mehr
Das Mädchen ohne Namen und ohne Herkunft
In dieser mit 140 Seiten sehr kurzen Geschichte begleitet der Leser ein sechsjähriges Mädchen eine kurze, sehr traurige Wegstrecke seines noch jungen Lebens.
Eines Tages wird dieses Mädchen in irgendeiner, nicht näher bezeichneten Stadt mitten im Winter einfach abgeladen. Es versteht die Sprache der dort lebenden Menschen nicht, es hat keinerlei Ahnung davon, wo es sich befindet. So,wie es nicht weiß, wo es ist, so erfährt der Leser nicht, wo es herkommt. Noch nicht einmal seinen Namen erfährt man. Mutterseelenallein muss sie sich zurechtfinden und sich durchs Leben schlagen. Ihr zartes Alter und ihre großen Kulleraugen sorgen dafür, dass die Menschen zumindest ab und zu Mitleid mit ihr haben. Sie geben ihr zu Essen , zu trinken, sogar ein wenig warme Kleidung. Eine Zeit lang " kümmern " sich auch zwei ältere Jungen in ähnlicher Lage mehr oder weniger um die Kleine. Doch sie ist und bleibt eine Fremde unter Fremden, allein ohne Familie.
Der Leser erlebt wie das Kind friert, hungert und auch krank wird. Als stiller Beobachter ist man entsetzt über ihr Schicksal und möchte so gerne helfen, ist jedoch völlig machtlos.
Der Autor bedient sich einer sehr schlichten Sprache ohne Schnörkel. Die einzelnen Sätze sind größtenteils sehr kurz und knapp, auf das Nötigste reduziert gehalten, passend zu einem kindlichen Gemüt. Sie muten dabei sehr nüchtern, beinahe sogar emotionslos an. Sie drücken für mich extrem starke Resignation aus, so wie sich das Kind vermutlich resigniert in sein Schicksal ergibt. Aber gerade diese sehr klaren, einfachen Worte treffen mitten ins Herz des Lesers. Man hofft und bangt dabei immer, dass sich das Schicksal des Mädchens irgendwie doch noch zum Guten wendet.
Aber in dieser Beziehung gibt es für den Leser keine Erlösung. Man wird vom Autor allein gelassen, allein mit seinen Gedanken und Gefühlen, genauso allein wie das Mädchen, ohne realistische Hoffnung und Aussicht auf eine positive Änderung der Situation.
Dieses kleine Büchlein liest sich aufgrund seines geringen Umfangs und seines Sprachstils sehr schnell. Dennoch wird es mir sicher noch sehr lange nachhaltig in Erinnerung bleiben. Es bietet viel Potential zum Nachdenken und sicher auch reichlich Diskussionsstoff.
Weniger
Antworten 4 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 4 von 4 finden diese Rezension hilfreich
Das Cover von "Das Mädchen mit dem Fingerhut"erweckte meine Neugier. Erstens klang der Titel recht interessant und zweitens waren es die Augen des Mädchens, die mich regelrecht anrührten. Ich fragte mich, warum sie so emotionslos erscheinen oder vielleicht auch eine gewisse …
Mehr
Das Cover von "Das Mädchen mit dem Fingerhut"erweckte meine Neugier. Erstens klang der Titel recht interessant und zweitens waren es die Augen des Mädchens, die mich regelrecht anrührten. Ich fragte mich, warum sie so emotionslos erscheinen oder vielleicht auch eine gewisse Resignation in ihnen zu lesen ist. Vielleicht ist es auch Traurigkeit? Unterschiedliche Interpretationen kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen und nachdem ich das Hörbuch nun beendet habe, könnte ich den Blick nun als trostlos, schutzsuchend oder eben doch als Augen betrachten, die eine Menge gesehen haben und diese verarbeiten müssen. Yiza ist ein Kind, ein kleines Mädchen und auf sich alleine gestellt. Der Onkel schickt sie zum Betteln und irgendwann kommt der Onkel nicht zur verabredeten Zeit zurück, um Yiza abzuholen. Was tun, wenn man nicht weiß wohin und die Nächte kalt sind? Hunger, Frieren und Angst werden verdeutlicht. Ein kleines Mädchen irgendwo in Westeuropa. Nicht utopisch, denn wenn wir uns unsere Welt betrachten, ist sicherlich nicht nur ein kleines Mädchen hilflos und allein unterwegs. Angewiesen auf Hilfe und Menschen, die sich kümmern. Es sind einige, die Yizas Weg kreuzen und ihr Hilfe anbieten durch Essen, Trinken und Wärme. Als Yiza ins Heim kommt, gerät sie in die Obhut zweier Jungen. Sie verlassen das Heim und kämpfen sich alleine durch, ohne die Hilfe Erwachsener und erneut wird gegen Hunger und Kälte gekämpft.
Brutal ehrlich und ich rate zwischen den Zeilen zu hören. Leider hat mir die Stimme des Autors nicht wirklich gefallen. Es hat mich nicht packen können, denn mir fehlte oft die richtige Betonung und Emotionen wurden auch nicht immer verdeutlicht. Die Story rund um Yiza ist authentisch und ging mir auch recht nah, dennoch hätte ich aufgrund des Klappentextes mehr erwartet. "Das Mädchen mit dem Fingerhut" ist ein Hörbuch ohne Hoffnung und ohne Wohlfühleffekt. Es regt zum Nachdenken an und hinterlässt hier und da echtes Grauen. Ein Kind ist unterwegs und auf Hilfe angewiesen. Als Hilfe naht, wird diese erschlagen und hat mich sehr bestürzt, denn für Yiza hätte es vielleicht die Chance auf ein Zuhause geboten.
Genervt hat mich, das Worte oft wiederholt wurden, um Sprachbarrieren zu verdeutlichen. Sinnig auf der einen Seite, aber in einem Hörbuch etwas gewöhnungsbedürftig.
Eine eingeschränkte Hörempfehlung, da ich irgendwie das gewisse Etwas vermisst habe. Lag es an der vorgetragenen Stimme oder einfach an den blassen Protagonisten? Ich kann es leider selbst nicht benennen, Vielleicht war meine Erwartungshaltung auch einfach zu groß?
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
In diesem Buch greift Michael Köhlmeier die aktuelle Thematik der allein reisenden Flüchtlingskinder auf, die uns in Westeuropa zur Zeit der Flüchtlingsströme intensiv beschäftigt. Er zeichnet ein Bild unserer derzeitigen Gesellschaft auf, das betroffen macht und ratlos …
Mehr
In diesem Buch greift Michael Köhlmeier die aktuelle Thematik der allein reisenden Flüchtlingskinder auf, die uns in Westeuropa zur Zeit der Flüchtlingsströme intensiv beschäftigt. Er zeichnet ein Bild unserer derzeitigen Gesellschaft auf, das betroffen macht und ratlos zurück lässt.
Man erlebt ein Mädchen irgendwo in Westeuropa, das Tag für Tag darauf angewiesen ist, Nahrung von hilfsbereiten Menschen zu bekommen, deren fremde Sprache sie nicht versteht. Sie schliesst sich zwei Jungen an, die ebenfalls allein und ohne Obdach leben. Woher die Kinder kommen wird nicht klar, sie stehen für die vielen ungenannten Flüchtlingskinder abseits der Hilfsprogramme.
In der kleinen Gemeinschaft übernimmt Shamhan, ein 14-jähriger Junge die Rolle des Anführers und sorgt bedingungslos für die Jüngeren. Trotz Sprachbarrieren untereinander kommen sie wie in einer Familie miteinander klar und stehen füreinander ein. Es ist Winter und gemeinsam versuchen sie ihre Grundbedürfnisse nach Nahrung und einer warmen Zuflucht in der Nacht zu erfüllen. Allerdings scheren sie sich nicht um Recht und Anstand, sondern sie stehlen, betteln und brechen in fremde Häuser ein. Doch woher sollen sie Regeln und Gesetze kennen und achten, wenn sie um ihr Überleben kämpfen und keine Erwachsenen sie anleiten und ihnen Werte vorleben.
Die Sprache ist nüchtern, knapp und sehr einfach gehalten. Kurze Sätze versinnbildlichen die Sprachlosigkeit und Fremdheit der Kinder in dieser fremden Welt. Man glaubt Yiza sprechen zu hören.
Michael Köhlmeier schafft mit seinem Buch eine berührende Geschichte, die mich traurig macht, fassungslos, wütend und gleichzeitig ratlos zurück lässt. Die Schicksale der Kinder machen betroffen, aber gleichzeitig auch Angst, wenn man die aktuelle Situation begreift. Denn auch die Polizei, Sozialarbeiter in Jugendheimen und hilfsbereite Menschen können an der Überlebensmentalität der Kinder in der Geschichte scheinbar nichts ändern. Eine Kriminalisierung scheint vorprogrammiert zu sein.
Ein gesundes Miteinander oder Integration kann man nicht verordnen, so wie es zur Zeit die Politiker gerne darstellen. Die Einbindung muss auch gewollt werden. Bei diesen Jugendlichen scheint es nicht zu klappen, obwohl helfende Hände sich ihnen entgegenstrecken.
Ein nachdenklich machendes Buch über die derzeitige Flüchtlingsproblematik Minderjähriger. Es macht die schwierige Situation beider Seiten bewusst.
Weniger
Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ein Mädchen in einem fremden Land wird von einem Mann jeden Tag zum Marktplatz gebracht, um sich ihr Essen zu erbetteln. Sie versteht die Sprache nicht. Eines Tages ist der Mann weg und das Mädchen verläuft sich. Sie kommt in ein Kinderheim, aber flieht mit zwei Jungs von dort. Nun …
Mehr
Ein Mädchen in einem fremden Land wird von einem Mann jeden Tag zum Marktplatz gebracht, um sich ihr Essen zu erbetteln. Sie versteht die Sprache nicht. Eines Tages ist der Mann weg und das Mädchen verläuft sich. Sie kommt in ein Kinderheim, aber flieht mit zwei Jungs von dort. Nun schlagen sie sich zu dritt durch die Welt, im Kampf gegen Hunger und Kälte.
Eine eigentlich berührende Geschichte, die gerade durch die wenigen Hintergrundinformationen wie Schauplatz und Zeit, überall sein könnte. Auch das Kind könnte jedes sein, sie steht für die viele namenslosen Kinder, die auf der Straße leben müssen. Obwohl mich die Geschichte erschreckt und zum Teil auch fassungslos gemacht hat. Hat sie mich dennoch nur wenig berührt. Das lag zum Einen am sehr nüchternen Sprachstil des Autors. Einfach schnörkellos und kurze Sätze, kaum Beschreibungen. Auch bekam ich keinen wirklichen Zugriff auf die Gedanken- und Gefühlswelt des kleinen Mädchens. Erst spät kamen für mich Emotionen auf. Des Weiteren blieben für mich einfach zu viele Fragen offen, alles blieb sehr wage. Auch das Ende blieb offen. Für mich ohne einen Hoffnungsschimmer.
Es ist kein schlechtes Buch, aber es hat mich wenig bewegt und ich würde es nicht weiterempfehlen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
„Das Mädchen mit dem Fingerhut“ von Michael Köhlmeier ist eher kein Roman, sondern mit seinen 140 Seiten und recht großer Schrift mehr eine Erzählung, die man auch bequem an einem Nachmittag lesen kann.
Es geht um ein junges Mädchen, der Leser erfährt …
Mehr
„Das Mädchen mit dem Fingerhut“ von Michael Köhlmeier ist eher kein Roman, sondern mit seinen 140 Seiten und recht großer Schrift mehr eine Erzählung, die man auch bequem an einem Nachmittag lesen kann.
Es geht um ein junges Mädchen, der Leser erfährt weder ihren Namen, noch ihr genaues Alter, das vermutlich als Flüchtling in ein westeuropäisches Land kommt, dessen Sprache sie nicht spricht. Zunächst ist sie mit einem Mann zusammen, den sie Onkel nennt, der sie jedoch bald verlässt. Dann kommt sie in ein Heim und schließt sich dort zwei Jungen an, mit denen sie sich ab sofort durchschlägt.
Der Schreibstil ist geprägt von kurzen, schnörkellosen Hauptsätzen, die am Anfang gut die Ratlosigkeit und das Verlorensein des Mädchens zeigen. Mit der Zeit wird dieser Stil aber dann doch recht anstrengend zu lesen, da vor allem Emotionen darüber nicht wirklich transportiert werden.
So ganz konnte mich das Buch leider nicht überzeugen. Es ist nicht schlecht, aber wenn ich jemandem erklären müsste, warum er gerade dieses Buch lesen sollte, würde mir nicht viel einfallen. Die Geschichte ist sicher interessant und im Moment auch sehr relevant, bringt aber auch keine neuen Gedanken zu dieser Thematik. Und bei der Kürze der Geschichte finde ich 18.90 Euro für ein Hardcover tatsächlich auch ziemlich teuer. 3 von 5 Sternen von mir.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Dieser Roman handelt von einem kleinen Mädchen, welches von „ihrem Onkel“ morgens am Markt abgesetzt wird, sich in einem Laden hinstellen soll, wo sie Essen und Trinken bekommt, und der Onkel sie am Abend an einem gemeinsamen Treffpunkt wieder mitnimmt. Bis der Onkel eines Tages …
Mehr
Dieser Roman handelt von einem kleinen Mädchen, welches von „ihrem Onkel“ morgens am Markt abgesetzt wird, sich in einem Laden hinstellen soll, wo sie Essen und Trinken bekommt, und der Onkel sie am Abend an einem gemeinsamen Treffpunkt wieder mitnimmt. Bis der Onkel eines Tages nicht am vereinbarten Treffpunkt auftaucht. Das Mädchen, welches sich selbst irgendwann Yiza nennt, kommt in ein Heim, wo sie kurz darauf mit dem 14-jährigen Schamhan und dem jüngeren Arian flieht. Sie schlagen sich irgendwie durch, überstehen Hunger und Kälte. Aber sie haben sich, und Schamhan spricht die Sprache von Yiza, Arian spricht eine andere Sprache, die aber Schamhan auch kann. So ziehen sie für kurze Zeit durch die Straßen, schlafen im Wald, bis sie von der Polizei aufgegriffen werden.
Michael Köhlmeier hat mit dem Thema dieses Romans voll ins Schwarze getroffen.
Der Schreibstil ist klar und emotionslos. Man denkt bei dieser Geschichte sofort an die aktuelle Flüchtlingssituation und ich verglich sofort diese drei verlorenen, elternlosen Kinder damit. Dieser Roman ist kurzweilig, der Schreibstil berührt einen emotional nicht, doch die Geschehnisse hinter den Worten hauen einen um, die Geschichte um diese heimat- und elternlosen Kinder ergreift einen zutiefst. Und sie lässt einen betroffen und nachdenklich zurück.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Irgendwo, eine Stadt in Westeuropa. Ein kleines Mädchen, dass von einem "Onkel" zum betteln geschickt wird, aber irgendwann verlieren sie sich und das Mädchen versucht sich selber durchzuschlagen. Sie landet dabei in einem Kinderheim, doch schon in der ersten Nacht hängt sie …
Mehr
Irgendwo, eine Stadt in Westeuropa. Ein kleines Mädchen, dass von einem "Onkel" zum betteln geschickt wird, aber irgendwann verlieren sie sich und das Mädchen versucht sich selber durchzuschlagen. Sie landet dabei in einem Kinderheim, doch schon in der ersten Nacht hängt sie sich an zwei ältere Jungen, die mit ihr fliehen.
Es ist Winter und eisig kalt. Die drei, das Mädchen (ein eigenen Namen hat sie nicht, sie kann sich nur erinnern, oft Yzra gennant worden zu sein), der Große (Schamhan) und der Freund (Arian), haben keine gemeinsame Sprache. Nur Schamhan kann sich mit beiden verständigen, da er mehrere Sprachen beherrscht.
Die Kleine, der Große und der Freund kämpfen ums Überleben und ihre Mittel dazu heißen Einbruch und Diebstahl. Sie bekommen auch Hilfe, aber sie sind misstrauisch und wollen oder können kaum Hilfe annehmen, die Gründe dafür sind manchmal offensichtlich, manchmal aber auch nicht verständlich.
Das Buch ist kein Roman, auf knapp 140 Seiten klingt die Erzählung meist sehr nüchtern . Der Focus liegt auf dem kleinen Mädchen, die Sichtweisen wechseln aber manchmal auch zwischen dien Kindern.
Emotionen werden vor allem im Mittelteil geweckt, das Ende hingegen ist offen und lässt vlel Spielraum zur Interpretation.
Anfangs wird sehr detailliert beschrieben, was die Kinder erleben. Im späteren Ablauf gibt es Sprünge im Ablauf, so dass man am Ende etwa 3 bis 6 Monate das Leben der Kleinen mitverfolgen kann.
Alles bleibt ziemlich vage. Der Ort, der Name, das Alter, daher kann diese Geschichte überall passiert sein, überall passieren.
Gerade nach den jüngsten Meldungen über verschwundenen Flüchtlingskinder, wird man hellhörig, wenn man diese Geschichte gelesen hat. Eine moderne Geschichte ums Überleben. Um Gut und Böse und um die Entwicklung in die eine oder andere Richtung.
Es ist keine Geschichte, die Hoffnung versprüht, im Gegenteil, ein modernes trauriges Märchen, das wiederum aber auch kein Märchen ist, sondern auch Alltag sein kann. Gestern. Heute. Morgen.
Die Sätze im Buch sind kurz und knapp.
Ich bin lange unschlüssig gewesen, gefällt mir die Erzählweise ? Sie scheint immer nur das offensichtliche zu beschreiben, kaum Gedanken oder Hoffnungen, wie einer, der die Kinder nur von außen sieht und beschreibt. Tragisch ist diese Geschichte, sie rührt einen, schreckt einem aber auch manchmal ab und es bleibt vieles im Dunkeln.
Hoffnung jedoch gibt es nicht.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Inhaltsangabe:
Meine Meinung und Zusammenfassung :
Es ist mein erstes Buch das ich von dem Autor Michael Köhlmeier gelesen habe. Mir sprang sofort dieser Cover und der Titel „ Das Mädchen mit dem Fingerhut „ ins Auge. Ich dachte mir was mag sich hinter der Geschichte …
Mehr
Inhaltsangabe:
Meine Meinung und Zusammenfassung :
Es ist mein erstes Buch das ich von dem Autor Michael Köhlmeier gelesen habe. Mir sprang sofort dieser Cover und der Titel „ Das Mädchen mit dem Fingerhut „ ins Auge. Ich dachte mir was mag sich hinter der Geschichte verbergen , meine Neugier war geweckt. Auch fand ich den Cover sehr schön dezent und zurückhaltend gestaltet. Es blickt einem ein kleines Mädchen mit einem sehr ernsten Gesicht und unendlich traurigen großen und dunklen Augen an. Es scheint sich viel Kummer, Leid und Schmerz darin zu spiegeln.
Die Geschichte der kleinen 6 sechsjährigen Mädchen , das nicht weiß woher es kommt, noch wie es heißt und wer seine Eltern sind. Sie selbst gab sich den Namen Yiza. Wir begegnen ihr in irgend einer großen Stadt in Westeuropa, könnte auch hier in Deutschland sein. Der Autor lässt es unserer Fantasie überlassen. Die kleine Yiza wird von einem Mann auf die Straße gesetzt und zum betteln auf einen großen Markt geschickt. Er schickt sie zu einem bestimmten Stand, er verspricht ihr dort bekäme sie zu essen, genug das sie keinen Hunger mehr hätte. Es ist Bogdan, der sich ohne groß zu fragen um sie kümmert, das wieder holt sie ein paar Tage, und immer wurde sie wie versprochen am Abend abgeholt. Auf Bogdans Frage wie sie heiße antwortet sie mit Kopfschütteln, sie versteht die Leute nicht, nur das Wort Polizei, wenn sie das hört schreit sie. Aber eines Abend kommt der Mann nicht wie versprochen, Yiza irrt durch die dunkle und kalte Stadt, sie friert ist müde, die Menschen eilen an ihr vorbei, keiner nimmt sie wahr, es ist als sei sie unsichtbar.Bis eine Polizei streife anhält, sich ihrer annimmt und auch hier gibt es Sprachprobleme, man bringt sie in ein Waisenhaus. Dort. Ist man sogleich sehr bemüht um sie, besonders die Schwester dort hat die kleine sofort in ihr Herz geschlossen. Aber trotzdem, lässt sie sich von den zwei Jungen dort Schamhan der größere und Arian den kleineren, trotz Sprachschwierigkeiten überreden mit ihnen abzuhauen. Arian schenkt ihr seinen Fingerhut. Diese drei Kinder sind nun auf der Flucht, sie kämpfen um ihr überleben, sind geplagt von Hunger , Kälte und keinem Dach über dem Kopf, kein Geld. Eine sehr Abenteuerliche Flucht die da beginnt, verfolgt, gejagt, suchen sie einen Ausweg aus der Misere. Eine Geschichte voller überraschender und ungeahnter Wendungen. Man bangt und hofft mit ihnen, das sie es schaffen werden.
Der Autor schafft es mit dieser Geschichte tief zu berühren und zu fesseln, das ganze geht einem sehr unter die Haut. Sein Schreibstil ist sehr Klar, Kraftvoll, fesselnd und schon fast Poetisch. Der Roman erinnert mich an das Märchen von Christian Andersen „ Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ , auch dort steht ein armes Mädchen, hungernd und frierend in der Kälte und keiner beachtet es, und denken zuerst an sich. Sehr deutlich führt er den Überlebenskampf der drei Kinder einem vor Augen, Menschen die am Rande unserer Wohlstandsgesellschaft Leben. Mir kommt es vor wie ein Fingerzeig und regt einem unwillkürlich zum Nachdenken an.Seine Protagonisten sind sehr Bildhaft, real und lebendig geschildert, ebenso die einzelnen Charaktere, ihre Ängste, Gefühle und Emotionen sind spürbar. Der Handlungsaufbau der Geschichte ist Glaubhaft und zeigt die Seiten des Lebens auf dieser Welt, die die im Schatten und die im Licht leben. Ein sehr Facettenreicher Roman...
„ Eine Geschichte die tief berührt und unter die Haut geht „
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für