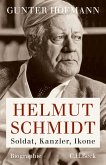Der Vater, Jahrgang 1893, kleiner Angestellter bei einer großen Wirtschaftsprüfungsfirma, dokumentiert zwischen 1951 und 1973 sein Arbeitsleben in einer Serie von Notizkalendern. Zunächst bleibt rätselhaft, wozu er sie braucht: Um seinen Vorgesetzten jederzeit Auskunft über seine Arbeitsorte und -zeiten geben zu können? Um seine Einnahmen und Ausgaben unter Kontrolle zu halten? Oder gar, um sich des Aufschwungs zu vergewissern, den die junge Bundesrepublik unverkennbar nimmt? Und dann wirken sich die Merkbücher des Vaters auch noch als Vorbilder in seiner Familie aus. Mutter und Sohn beginnen ebenfalls, in Notizkalendern ihren Alltag aufzuschreiben, sogar ausführlicher als der Vater. Das Büchlein funktioniert als eine Art Tagebuch vor dem Tagebuch, als Literatur vor der Literatur. Michael Rutschky rekonstruiert anhand der Notizen einer Familie deren Leben in der frühen Bundesrepublik. Doch er liefert mehr: Die Notizen über Zugabfahrtszeiten, Wocheneinkäufe und Klassenarbeiten ergeben nach und nach nicht nur die Geschichte einer Familie, sondern, im Zusammenhang betrachtet, eine eindrucksvolle und anrührende Frühgeschichte der Bundesrepublik.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Ein bisschen merkwürdig ist das schon, in der Beziehung zum Vater den Saldo aufzurechnen, wie Hannes Hintermeier das macht, zumal es um Michael Rutschkys Vater geht. Dessen Merkbücher, Buchprüfer-Notizen aus der Wirtschaftswunderzeit, nichts von Belang eigentlich, nobilitiert der Sohn hier zum Anstoß für das eigene literarische Schaffen, wie Hintermeier feststellt, und zur kleinen Weltgeschichte. Von daher grüßt nicht nur der Vater aufgrund von dürrer Datenbasis (Spesenrechnung, Abfahrtszeiten etc.) aus den 50ern herüber, sondern auch Kuba-Krise, Nixon, ApO. Dazwischen wird für Hintermeier etwas zu viel montiert und spekuliert vom Autor - über amouröse Verhältnisse des Vaters und anderes Romanhafte mehr.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Auferstanden aus Schwefeldämpfen: Michael Rutschky studiert die Notizbücher seiner Vaters und findet darin einen Arbeitsroman aus den Anfängen des deutschen Wirtschaftswunders.
Auch vermeintlich banale Existenzen bilden Ausgangspunkte für literarische oder soziologische Expeditionen. In "Das Buch der Unruhe" schreibt Fernando Pessoa: "Wir alle, die wir träumen und denken, sind Hilfsbuchhalter in einem Stoffgeschäft oder in irgendeinem andern Geschäft in irgendeiner Unterstadt. Wir führen Buch und erleiden Verluste; wir zählen zusammen und gehen weiter; wir ziehen Bilanz, und der unsichtbare Saldo spricht immer gegen uns."
Michael Rutschkys Vater war kein Hilfsbuchhalter, er war schon höher gestiegen, reiste als Externer durchs Land, um "die Bücher zu prüfen". Über seine Dienstfahrten führte er ein sehr knappes Protokoll in Notizbüchern, die er "Merkbücher" nannte. Motto: Strikte Sachlichkeit!
Zweiundzwanzig Kalender versteckte er im Geheimfach seines Biedermeier-Sekretärs. Sein Sohn hat eine Archäologie der Nachkriegszeit daraus gewonnen, die er als "eine Vatergeschichte" verstanden wissen will. Tatsächlich ist das Buch eher eine Vatersuche auf dürrer Datenbasis. Vorschüsse, Spesen, Mittagbrot, Abfahrtszeiten, Schulden, Blumen, Schokolade. Persönliches war, jenseits der Kleidergröße seiner Frau, in diesen Notizen nicht vorgesehen. Keine Erwähnung des einzigen Kindes, keine Notiz vom Tod der verhassten Schwiegermutter: "Das waren keine Daten, die der persönliche Geschäftsbericht anzuführen hätte." Man arbeitete sechs Tage: "Wie Gott!, hätte Vater gefeixt."
"Es drängt sich die Erinnerung auf, dass Schwefel der Gestank der Hölle ist." Die Firma Spinnfaser in Kassel-Bettenhausen konnte bei der geruchsintensiven Produktion von Zellwolle rasch wieder an das Vorkriegsniveau anschließen, obwohl man der Hölle erst sechs Jahre entronnen war. Rutschky senior, Jahrgang 1893, ist 1951 schon zu alt, um am Wirtschaftswunder zu partizipieren. Zwar heiratet er eine viel jüngere Frau, lässt diese aber allein in der nordhessischen Provinz sitzen, während er über Wochen, manchmal Monate, durch die junge Republik fährt und Firmen prüft, deren Namen heute verschwunden sind, die aber wichtige Rollen im Nachkriegsdeutschland spielten - und die teilweise in der Zeit der Hitlerdiktatur prächtig verdient hatten.
Etwa die Darmstädter Firma Röhm & Haas, die 1933 das Plexiglas erfand und ein wichtiger Lieferant der Luftwaffe wurde: Nach 1945 verdiente das Unternehmen prächtig an der Erschaffung der Plastikwelt, auch der Messerschmitt-Kabinenroller fuhr mit einem Dach von Röhm & Haas vor. Kühne + Nagel, Vereinigte Stahlwerk in Frankfurt am Main, ebenda Generatorkraft, Hommelwerke Mannheim, das waren andere Kunden von Franz Rutschky. Ebenso wie die Vereinigten Glanzstoff-Fabriken, in denen die Kunststofffasern Perlon, Nylon, Dralon und Diolen hergestellt wurden, mit denen sich die neue Zeit umgarnen lässt.
Derweil entdeckt der heranwachsende Sohn Fluchtwege in Science-Fiction-Welten ("Die Merkurianer haben angegriffen, nichts erreicht."). Und lebt doch mitten im Kalten Krieg: Churchill, de Gaulle, Kennedy, Chruschtschow, Nixon, Ungarn-Aufstand, Kuba-Krise, schließlich Vietnam und Studentenrevolte. Rutschky unterfüttert seinen Stoff mit Hilfe von weltgeschichtlichen Ereignissen und durch die Montage von Zitaten, darunter Thomas Mann, Heidegger, Camus, Benjamin, Schumpeter, Kracauer, Don De Lillo. Obendrein werden psychoanalytische Deutungen angeboten, wenn auch gelegentlich mit einem Augenzwinkern. Das erinnert an Walter Kempowskis Montageverfahren, dem hier aber vermutlich zu viel spekuliert worden wäre.
Denn Rutschky lässt seiner Vaterphantasie bald vierzig Jahre nach dessen Tod freien Lauf. So zeigt er den begeisterten Binnensegler als routinierten Frauenhelden, der in jedem Hafen, den er beruflich anläuft, eine andere Braut gehabt haben könnte - in jenem Jahr 1953 von dem es kein Merkbuch gibt. Das ist der angreifbarste Punkt dieser Recherche, der unbedingte Wille, "das Spiel", einen Roman herauslesen zu wollen. Das gelingt nicht ohne die Merkbücher seiner Mutter und nicht ohne seine eigenen. Die Mutter, gelernte Retuscheurin und eine Anhängerin Thomas Manns, investiert viel Geld in Bücher; und das in einem Haushalt, der auf jeden Pfennig achten muss, der sich nur mühsam aus Verhältnissen herausarbeitet, die jüngeren Lesern unvorstellbar erscheinen werden. Aber: Der Sohn besucht in Melsungen das Gymnasium, eine Aufsteigerbiographie wird angelegt. Austauschschüler in England, Busreisen der Mutter, mehrmaliger Wohnungswechsel in komfortablere Umstände.
Als das Kapital seine Kräfte wieder gebündelt, der Konsumismus seine Fühler nach der Kundschaft ausgestreckt hat, kommt der Vatergeschichte der Protagonist abhanden. Denn Rutschky senior gibt die Rolle des Merkbuch-Schreibers an Frau und Sohn ab, die sich ihm anverwandeln. Mit dem erzwungenen Ende der Berufslaufbahn - man trägt ihn fort, als er einen Kontrollverlust erleidet -, beginnt eine lange, traurige Phase des Verlusts für den Biographen, der immerhin die Merkbücher als den Auslöser seiner ersten poetische Ergüsse nobilitiert: Am Anfang aller Literatur steht die Aufzählung, die Liste.
Am 9. November 1973 stirbt Franz Rutschky in einem Pflegeheim, am deutschen Schicksalsdatum also. Dieser Umstand hebt ihn für den Sohn noch einmal heraus aus der unscheinbaren Angestelltenexistenz, die er geführt hat. Michael Rutschkys Saldo seinem Vater gegenüber spricht also nicht gegen ihn: Er hat ihn in der Rekonstruktion einer Epoche wiedergewonnen.
HANNES HINTERMEIER
Michael Rutschky: "Das Merkbuch". Eine
Vatergeschichte.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2012. 274 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main