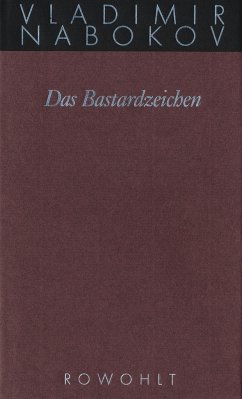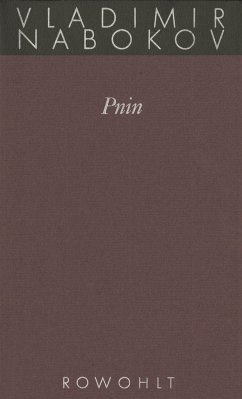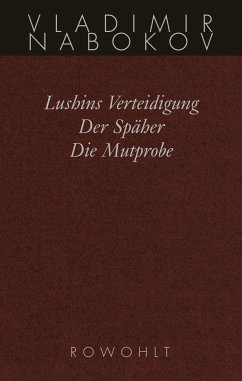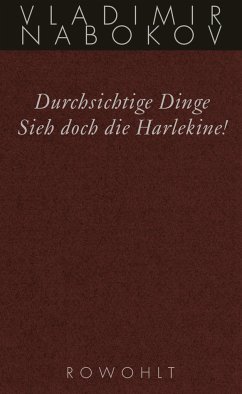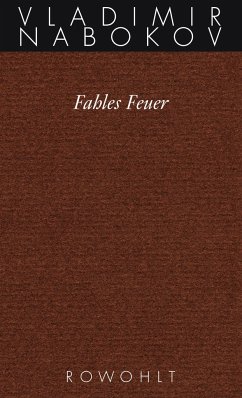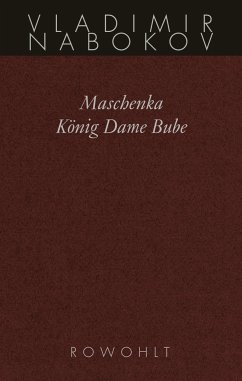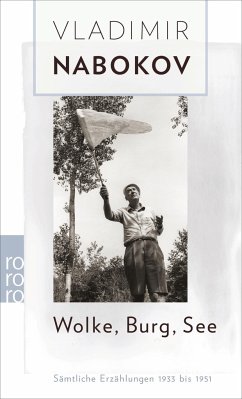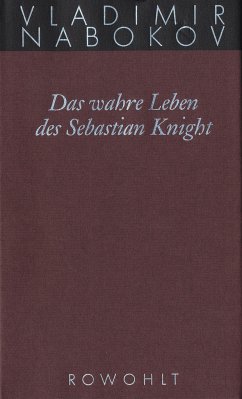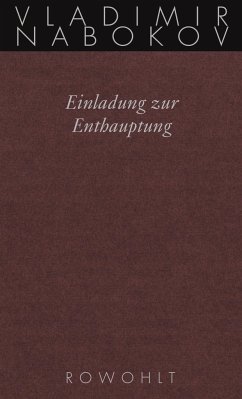Nicht lieferbar

Das Modell für Laura
Sterben macht Spaß
Mitarbeit: Nabokov, Dmitri;Übersetzung: Zimmer, Dieter E.; Tolksdorf, Ludger
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
"Nabokovs legendenumwobener letzter Roman - ein literarisches Ereignis."
Das Modell für Laura - Vladimir Nabokovs letztes Meisterwerk aus dem Nachlass des berühmten Autors von Lolita
In seinen letzten Lebensjahren von 1961 bis 1977 wohnte Nabokov im Palace Hotel in Montreux, wo er an seinem letzten Roman Das Modell für Laura arbeitete. Dieser unvollendete Text aus dem Nachlass des Schriftstellers gewährt einen faszinierenden Einblick in Nabokovs kreatives Schaffen und literarische Brillanz. Ein Muss für alle Liebhaber klassischer Belletristik und Verehrer von Nabokovs unverwechselbarem Stil.
In seinen letzten Lebensjahren von 1961 bis 1977 wohnte Nabokov im Palace Hotel in Montreux, wo er an seinem letzten Roman Das Modell für Laura arbeitete. Dieser unvollendete Text aus dem Nachlass des Schriftstellers gewährt einen faszinierenden Einblick in Nabokovs kreatives Schaffen und literarische Brillanz. Ein Muss für alle Liebhaber klassischer Belletristik und Verehrer von Nabokovs unverwechselbarem Stil.