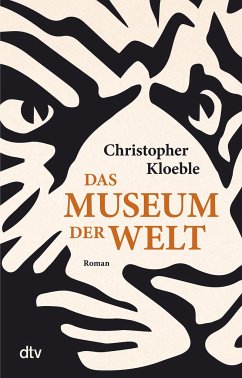Ein indischer Waisenjunge auf der Reise seines Lebens
Bartholomäus ist ein Waisenjunge aus Bombay, mindestens zwölf Jahre alt und er spricht fast ebenso viele Sprachen. Daher engagieren ihn die deutschen Brüder Schlagintweit, die 1854 mit Unterstützung Humboldts zur größten Forschungsexpedition ihrer Zeit aufbrechen, als Übersetzer für ihre Reise durch Indien und den Himalaya. Bartholomäus folgt ihnen fasziniert, aber misstrauisch: Warum vermessen ausgerechnet drei Deutsche das Land, sammeln unzählige Objekte, wagen sich ins unbekannte Hochgebirge, riskieren ihr Leben? Es ist doch seine Heimat - und er will der Mann werden, der das erste Museum Indiens gründet.
Bartholomäus ist ein Waisenjunge aus Bombay, mindestens zwölf Jahre alt und er spricht fast ebenso viele Sprachen. Daher engagieren ihn die deutschen Brüder Schlagintweit, die 1854 mit Unterstützung Humboldts zur größten Forschungsexpedition ihrer Zeit aufbrechen, als Übersetzer für ihre Reise durch Indien und den Himalaya. Bartholomäus folgt ihnen fasziniert, aber misstrauisch: Warum vermessen ausgerechnet drei Deutsche das Land, sammeln unzählige Objekte, wagen sich ins unbekannte Hochgebirge, riskieren ihr Leben? Es ist doch seine Heimat - und er will der Mann werden, der das erste Museum Indiens gründet.
'Das Museum der Welt' von Christopher Kloeble ist ein schillernder Abenteuerroman. Thomas Neubacher-Riens Frankfurter Neue Presse 20201019

Eine humoristische Verkehrung von Cultural Appropriation? Christopher Kloeble beschreibt die Fremderforschung Indiens aus der Sicht eines indischen Jungen.
Indien, um 1854. Große Teile des Subkontinents fallen in den Herrschaftsbereich der East India Company, die regen Handel mit Tee, Gewürzen und Opium betreibt. Es ist die Zeit der "Doctrine of Lapse", einer vom britischen Parlament legitimierten Annexionspolitik, die die Kompanie dazu befähigt, jeden indischen Staat, dessen Herrscher mangels Erben ein Nachfolgeproblem hat oder der sich als "inkompetent" erweist, zu übernehmen.
Im Windschatten der Fremdherrschaft erblüht die Neugier der europäischen Wissenschaften auf den Vielvölkerstaat. Unzählige britische und auch unter preußischer Flagge stehende Expeditionen, Forschungsreisende mit geologischem, botanischem oder "rassenkundlichem" Interesse ziehen los, um den Kontinent zu vermessen. Viele werden nicht zurückkehren. Diejenigen, denen es gelingt, bringen Landkarten, Schädel und Mineralien zurück nach Hause. Ihre Erkundungen schaffen Wissen für das Empire und damit Macht für imperiale Eroberungen.
Unter den Forschungsreisenden sind auch die bayerischen Brüder Schlagintweit, deren historischer Expedition sich Christopher Kloebles Roman "Das Museum der Welt" annimmt. Hermann, Adolph und Robert sind schon in jungen Jahren profilierte Wissenschaftler. Auf Empfehlung Alexander von Humboldts erteilt ihnen die East India Company den Auftrag zur Kartierung entlegener Regionen Indiens, die Kosten trägt der preußische König. Nur zwei der Brüder kehren drei Jahre später nach Berlin zurück, im Gepäck Tausende von Karten und Aquarellen sowie Gipsabdrücke von Gesichtern, die dem Ziel dienen, eine Taxonomie der indischen Ethnien aufzustellen.
Kloeble ist ein ausgezeichnet informierter Autor. Für seinen Roman hat er die Schriften der Schlagintweits und die Humboldts studiert und sich ausführlich mit Flora und Fauna Indiens beschäftigt. Dabei ist ihm wohl zugutegekommen, dass er, wie er häufig in Interviews zu Protokoll gibt, die Hälfte des Jahres in Neu-Delhi lebt. Auch für die Erzählperspektive hat er sich, nicht unbedingt zum Vorteil seiner Leser, Besonderes überlegt. "Es gibt genug Bücher, in denen aus Sicht eines westlichen Mannes beschrieben wird, wie er das Fremde erlebt", sagt Kloeble in einem Interview über den Roman. Deswegen hat er den Spieß umgedreht und die Expedition aus Sicht eines indischen Jungen erzählt.
Bartholomäus ist "mindestens zwölf Jahre alt", wie es im Buch heißt, und ein genialer Übersetzer genauso vieler Sprachen. Seinen unwahrscheinlichen Namen, die Eloquenz und wohl auch die manierierte Altklugheit hat er von einem opiumabhängigen bayerischen Jesuitenpater, der ihn in einem Bombayer Waisenhaus zum Medium für die westliche Welt erzieht. Der Jesuit ist Bartholomäus gewogen, unterrichtet ihn in Deutsch, Farsi, Englisch, Hindi, Gujarati und anderen Sprachen und erzählt von Kant, Schlegel und Schiller. Was der Geistliche weiß, aber vor dem Jungen geheim hält: Bartholomäus hat einen preußischen Vater, der als Soldat an der Seite der Briten gegen den indischen Widerstand kämpfte. Danach verließ er das Land und seine indische Frau, die den Jungen den Jesuiten übergab. Bartholomäus ist also ein "Indo-Europäer", wie es im Buch heißt, und dass er vielleicht nur deshalb aus der Menge der namenlosen Waisen, die "die Anderen" genannt werden, herausgepickt wurde, hinterlässt einen faden Beigeschmack, ist aber eine der unterschwelligen Botschaften des Buches: Eigenes bleibt uns stets das Nächste.
Bartholomäus, der brillante Übersetzer, wird von den Schlagintweits zur Unterstützung ihrer Expedition angeheuert. Er reist mit ihnen kreuz und quer über den Kontinent, von Bombay über Pune nach Kalkutta und schließlich nach Nordindien und Nepal. Für die Brüder macht er sich unentbehrlich, weil er nicht nur, wie er sagt, die Sprachen, sondern auch das Land übersetzt. Nebenbei füllt er in elaboriertem Deutsch ein Notizbuch mit eigenen Beobachtungen. Er hat das Ziel, Indiens erstes Museum der Objekte zu gründen, was die fiktive Strukturparallele zu dem unermüdlichen Erfassungsdrang der Wissenschaftler darstellt. Hier beginnen die sprachlichen und inhaltlichen Manierismen, die die über fünfhundert Seiten des Romans in eine zähe Lektüre verwandeln.
Wenn etwa Bartholomäus unwahrscheinliche Scheindialoge mit einem indischen Widerstandskämpfer über die Neutralität von Wissenschaft führt und darauf besteht, Humboldt sei "der größte Wissenschaftler unserer Zeit" und so zu achten wie "Mangos im perfekten Reifezustand". Ohnehin führt seine eifrige Begeisterung für den Westen zu einigen altersungemäßen Betrachtungen. Er sinniert über den schönen Klang des Wortes "Freundschaft". "Auf Deutsch hat mir dieses Wort immer am besten geschmeckt, besser noch als auf Hindi oder Marathi", und später: "Ist Schadenfreude nicht eines der besten deutschen Worte? Sie macht mein Herz groß." Wären dieser Stilblüten nicht so viele, könnte man von einer humoristischen Verkehrung kultureller Aneignung sprechen. Unfreiwillig heiter wird es da, wo Bartholomäus sich selbst als der größte unter den Kolonialherren erweist. Einmal stellt er fest, die geschätzte eifrige Köchin habe die Küche so rasch unter ihre Kontrolle gebracht wie die Briten ein indisches Königreich. Ein anderes Beispiel: die Freude des Jungen darüber, dass die Brüder Schlagintweit in ihrem wissenschaftlichen Weltaneignungsgestus alles benennen, was ihnen den Weg kreuzt. Bartholomäus lernt "Gelbnackenspecht", "Schwarznarbenkröte" oder "Kletternatter" und bilanziert stolz: "Mein Wortschatz wächst täglich." Hatten diese Tiere nicht schon eine Bezeichnung in einer der indischen Sprachen, derer er auch mächtig ist?
Doch Bartholomäus hat viele Seelen in seiner Brust. Neben der Fetischisierung westeuropäischer Hochkultur wird er nämlich geplagt von einem angeborenen Widerspruchsgeist gegen das, was die Brüder als Zivilisation verstehen, die "in der weißen Rasse am kräftigsten" blühe. So fragt er sich, was an einem breit aufgestellten Schienennetz zur Fortbewegung nach europäischem Vorbild wohl attraktiv sei. Schließlich würde dadurch das Leben durch die Schienen so festgelegt "wie von den Konstellationen der Sterne". Oder wenn er das Reisen in der Sänfte ablehnt und lieber zu Fuß geht, um "in Berührung mit Indien" zu bleiben. Dieser artifizielle Primitivismus klingt im Roman häufig an. Die Imago des friedlichen Exoten erinnert an den Disney-Kassenschlager "Pocahontas", in dem die britischen Kolonisatoren von der schönen Häuptlingstochter singend gebeten werden, das nordamerikanische "Farbenspiel des Winds" zu achten.
Literarische Fiktion kann jede Perspektive einnehmen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass jeder, der Talent hat, auch jede Perspektive erfinden kann. Was das angeht, hat Christopher Kloeble sich mit der Schilderung einer europäischen Forschungsreise in Kolonialzeiten aus der Sicht eines indischen Jungen eine schwierige Aufgabe vorgenommen. Wenn es das erklärte Anliegen des Autors ist, "all jenen eine Stimme" zu geben, "die damals auch dabei waren, und die bisher nie gehört wurden", dann scheitert er an seinem Anspruch. Denn sein Ausnahmeprotagonist steht eben nicht für die Ungehörten, sondern dient als geschwätzige Echokammer all jener Kolonialphantasmen, die der Roman vorgibt auf Distanz zu bringen. So weit von sich selbst entfernt wie Bartholomäus können nur schlecht ausgedachte Subalterne sprechen.
MIRYAM SCHELLBACH
Christopher Kloeble:
"Das Museum der Welt".
Roman.
dtv, München 2020. 528 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Mit sprühendem Witz und auf so herzzerreißende wie tiefgründige Weise erkundet 'Das Museum der Welt' die Ambivalenz menschlicher Beziehungen in der Kolonialzeit.« Francesca Melandri