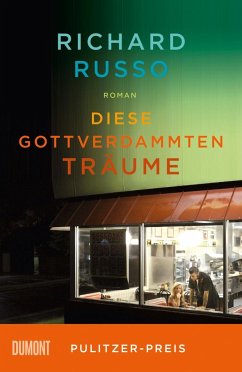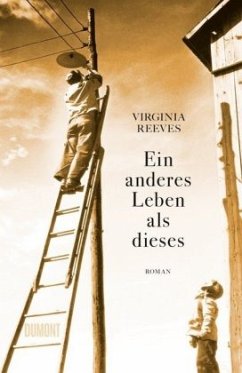Nicht lieferbar
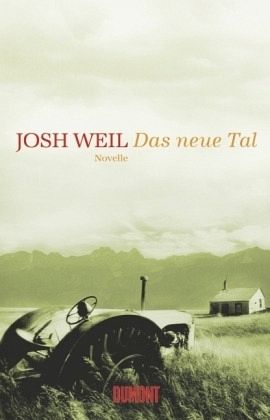
Das neue Tal
Novelle
Übersetzung: Kleiner, Stephan
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Stillman Wing ist 71 Jahre alt. Er lebt, wie schon der Held in Josh Weils erster, viel gelobter Novelle Herdentiere, in den Blue Ridge Mountains in Virginia. Gerade wurde ihm gekündigt. Um sich zu rächen, stiehlt er in einer Nacht-und-Nebel-Aktion das Schmuckstück aus der Traktorensammlung seines alten Bosses, den Deutz Diesel, Baujahr 1928. Fünf Jahre lang renoviert er ihn als Geschenk für seine Tochter. Er macht sich Sorgen um Caroline, sie ist schon 35, fettleibig und lebt in den Tag hinein, immer bringt sie neue, nutzlose Liebhaber nach Hause. Sie ist sein Ein und Alles. Und dann geht...
Stillman Wing ist 71 Jahre alt. Er lebt, wie schon der Held in Josh Weils erster, viel gelobter Novelle Herdentiere, in den Blue Ridge Mountains in Virginia. Gerade wurde ihm gekündigt. Um sich zu rächen, stiehlt er in einer Nacht-und-Nebel-Aktion das Schmuckstück aus der Traktorensammlung seines alten Bosses, den Deutz Diesel, Baujahr 1928.
Fünf Jahre lang renoviert er ihn als Geschenk für seine Tochter. Er macht sich Sorgen um Caroline, sie ist schon 35, fettleibig und lebt in den Tag hinein, immer bringt sie neue, nutzlose Liebhaber nach Hause. Sie ist sein Ein und Alles. Und dann geht sie, zieht zu den lauten Kommunarden am Ende des Tals, nimmt gefährliche rituelle Bäder in einem verseuchten Teich und erwartet ein Kind. Stillmans Welt gerät vollständig aus dem Gleichgewicht. Da steigt er zum ersten Mal auf den funkelnden Deutz und fährt dorthin, wo die Rinder begraben sind und wo die jungen Leute tanzen und singen.
Fünf Jahre lang renoviert er ihn als Geschenk für seine Tochter. Er macht sich Sorgen um Caroline, sie ist schon 35, fettleibig und lebt in den Tag hinein, immer bringt sie neue, nutzlose Liebhaber nach Hause. Sie ist sein Ein und Alles. Und dann geht sie, zieht zu den lauten Kommunarden am Ende des Tals, nimmt gefährliche rituelle Bäder in einem verseuchten Teich und erwartet ein Kind. Stillmans Welt gerät vollständig aus dem Gleichgewicht. Da steigt er zum ersten Mal auf den funkelnden Deutz und fährt dorthin, wo die Rinder begraben sind und wo die jungen Leute tanzen und singen.