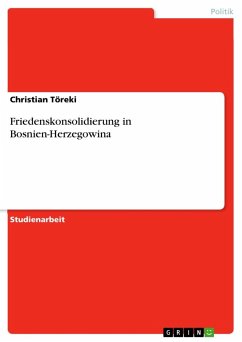In den meisten Postkonfliktländern verorten sich für einen gewissen Zeitraum diverse internationale Nichtregierungsorganisationen (NGOs), ausgestattet mit Geld und den besten Absichten. Sie nehmen sich kaum lösbarer gesellschaftlicher Konflikte an, sind nicht nur für die akute Nothilfe zuständig, sondern häufig auch für den Aufbau der Demokratie, für die ethnische Aussöhnung und für die Vergangenheitsbewältigung. Nach einiger Zeit ziehen die NGOs weiter und hinterlassen eine "losgelöste Zivilgesellschaft".
Das NGO-Spiel handelt von den unbeabsichtigten und nicht selten negativen Ergebnissen der Friedenskonsolidierung.
McMahons empirische Untersuchungen in verschiedenen Postkonfliktländern, ihre zahlreichen Interviews mit Menschen im Kosovo, Bosnien, aber auch z.B. in Vietnam, stützen die provokante These der Autorin, dass NGOs nicht so sehr eine Hilfe bei der Schaffung dauerhaften Friedens sind, sondern vielmehr Teil der anhaltenden Probleme in postkonfliktuellen Gesellschaften.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Das NGO-Spiel handelt von den unbeabsichtigten und nicht selten negativen Ergebnissen der Friedenskonsolidierung.
McMahons empirische Untersuchungen in verschiedenen Postkonfliktländern, ihre zahlreichen Interviews mit Menschen im Kosovo, Bosnien, aber auch z.B. in Vietnam, stützen die provokante These der Autorin, dass NGOs nicht so sehr eine Hilfe bei der Schaffung dauerhaften Friedens sind, sondern vielmehr Teil der anhaltenden Probleme in postkonfliktuellen Gesellschaften.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Judith Raupp kann Patrice McMahons Kritik an den Einsätzen internationaler Organisationen nachvollziehen: Immer wieder strömten NGO in Krisengebiete, stülpten den Gesellschaften ihre Standardlösungen über und zögen wieder ab, wenn eine andere Krise dräute. Raupp will das nicht bestreiten, findet aber McMahons Argumentation zu kurz gegriffen. Schließlich spielten auch viele Einheimische das Spiel mit, weil ihnen gutbezahlte Jobs winkten. Die große Frage ist für die Kritikerin vielmehr, warum sich nichts ändere, auch wenn allen Beteiligten klar sei, wie wenig der Einsatz der NGOs besonders im komplizierten Bereich der Friedenskonsolidierung bringe. Dass McMohan in ihren Buch keine alternativen Vorschläge präsentiert, hält die Raupp ebenfalls für ein Manko.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Knackige Thesen über das Wirken von Nichtregierungsorganisationen
In der Stadt Srebrenica ermordeten serbische Soldaten während des Bosnien-Krieges Tausende muslimische Jungen und Männer innerhalb weniger Tage. Nach Kriegsende konnten die Mütter und Witwen von Srebrenica mit Unterstützung internationaler Geldgeber eine eigene Organisation gründen, ihren Forderungen Gehör verschaffen und beginnen, ein dunkles Kapitel des Konfliktes aufzuarbeiten. Ihre bewegende Geschichte symbolisiert das "Versprechen der NGOs" als effiziente, progressive und authentische Vertreter der lokalen Zivilgesellschaft, an dem sich Patrice C. McMahon in "Das NGO-Spiel" abarbeitet.
Die Politikwissenschaftlerin argumentiert, dass die Realität der Nichtregierungsorganisationen (NGO) in Postkonfliktsituationen meist anders aussieht. Am Beispiel von Bosnien und des Kosovo skizziert sie Aufstieg und Niedergang aufgeblähter NGO-Sektoren, von denen nach dem Abzug der westlichen Gelder wenig mehr als enttäuschte Erwartungen zurückblieben. Sie greift dabei zurück auf eigene Feldforschung, Statistiken der Union of International Associations, Sekundärliteratur sowie Dokumente der UN und großer westlicher Geber.
"Frieden im weitesten Sinn kann nicht allein durch das System der Vereinten Nationen und die Staaten geschaffen werden", postulierte UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali 1992 in seiner "Agenda für den Frieden". Mit der Strategie der "liberalen Friedenskonsolidierung" stellte die Weltgemeinschaft in den neunziger Jahren Unterstützung und Aufbau der lokalen Zivilgesellschaft in den Mittelpunkt friedensschaffender Maßnahmen, so die Autorin. NGOs galten als Bindeglied zur Zivilgesellschaft und entscheidende Partner, um Ursachen gewaltsamer Konflikte anzugehen und Frieden nachhaltig zu sichern.
Nach dem Ende des Krieges in Bosnien wollte die internationale Gemeinschaft unter Führung der Vereinten Nationen das Land wiederaufbauen und Versöhnung zwischen den ethnischen Gruppen fördern. Mit viel Geld und Enthusiasmus, aber wenig Ahnung von lokalen Begebenheiten fiel der "Humanitäre Klub" (Barnett und Walker) Mitte der neunziger Jahre in Bosnien ein und ging bald von reiner Nothilfe zur Stärkung der Zivilgesellschaft über. Internationale NGOs gründeten lokale Ableger, staatliche und nichtstaatliche Akteure aus dem Westen schufen neue vermeintlich lokale NGOs oder gingen ungleiche Partnerschaften mit lokalen Akteuren ein, bei denen sie mit finanzieller Übermacht deren Agenda bestimmten.
Über kurz oder lang begannen die einheimischen Organisationen, Projekte nach Gusto der Geber zu kreieren, und konkurrierten untereinander um deren Gunst, statt sich gegenseitig zu vernetzen und zu stärken. Dabei agierten sie oft losgelöst von Bedürfnissen und Interessen der Bevölkerung, die sie doch repräsentieren sollten.
Gleichzeitig fehlte der internationalen Gemeinschaft eine gemeinsame, langfristige Strategie oder wenigstens eine effiziente Koordinierung der Hilfsaktivitäten. Die projektgebundene Finanzierungsstruktur verhinderte zusätzlich eine nachhaltige Ausrichtung der lokalen NGOs. Irgendwann nahmen das Interesse und das Geld der Geber ab. Von den vielen NGOs, die in dieser Zeit gegründet wurden, waren nur wenige zehn Jahre später noch aktiv. Trotz der finanzstarken "Förderung der Zivilgesellschaft" gilt diese heute als schwach und gespalten. "Wir (...) verschwenden das Geld der Menschen aus dem Westen, sie verschwenden unsere Zeit", zitiert McMahon den Direktor einer lokalen NGO aus Sarajevo. Er bringt die Dynamik, die sie als "Spiel" beschreibt, damit auf den Punkt.
Anders als in Bosnien gab es im Kosovo, den die Autorin als zweites Beispiel für das "NGO-Spiel" heranzieht, bereits vor der internationalen Intervention eine aktive und organisierte Zivilgesellschaft. Allerdings legt McMahon dar, dass diese sich auf die Bedürfnisse der albanischstämmigen Bevölkerung fokussierte und so nicht den Gebern und ihrer Vorstellung von einer friedensfördernden multiethnischen Zivilgesellschaft entsprach. Deshalb schufen sie auch im Kosovo viele neue NGOs. Gleichzeitig veränderten die finanziellen Zuflüsse die Anreize, sich gesellschaftlich zu organisieren. Die Zivilgesellschaft "NGOisierte" sich, wuchs und schrumpfte in Abhängigkeit von ausländischem Geld und Ideen.
Das "NGO-Spiel" ist eine Dynamik, die McMahon abschließend kurz für andere Postkonfliktsituationen nachzeichnet. Ihre zentralen Thesen wiederholt die Autorin so oft, dass am Ende wirklich jeder verstanden haben sollte, dass es zwar gute und wichtige NGOs gibt, die negativen Beispiele und unerwünschten Nebenwirkungen aber überwiegen. Das System der internationalen Finanzierung, der fehlenden Rechenschaftspflicht, der hierarchischen sogenannten Partnerschaften mit lokalen Akteuren, die sie auch als "wohlwollenden Kolonialismus" bezeichnet, kann sogar schädlich für die zivilgesellschaftliche Entwicklung in Postkonfliktgesellschaften sein.
All das ist richtig und wichtig genug, um es zu betonen, bis es Wirkung zeigt. Die beiden Fallbeispiele sind zudem spannend und sachkundig aufbereitet. Dass die Autorin so oft anpreist, wie neu und bedeutend ihre Erkenntnisse über Grenzen und Fallstricke der NGOs für die Disziplin der Internationalen Beziehungen seien, macht allerdings misstrauisch. In einer Fußnote entlarvt sie sich selbst und gibt den Hinweis, dass ihre Argumente im entwicklungspolitischen Diskurs und der Praxis längst bekannt sind. Was nun das "NGO-Spiel" in Postkonfliktsituationen grundlegend von Entwicklungszusammenarbeit in anderen Ländern oder auch vom Wiederaufbau nach Naturkatastrophen unterscheidet, arbeitet sie nicht heraus. Die reißerische Sprache, in die McMahon immer wieder verfällt, lässt zwar über manch holprige Übersetzung schnell hinweglesen, den knackigen Thesen hätte aber etwas mehr Substanz gutgetan.
MONIKA REMÉ
Patrice C. McMahon: Das NGO-Spiel. Zur ambivalenten Rolle von Hilfsorganisationen in Postkonfliktländern.
Verlag Hamburger Edition, Hamburg 2019. 312 S., 35,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main