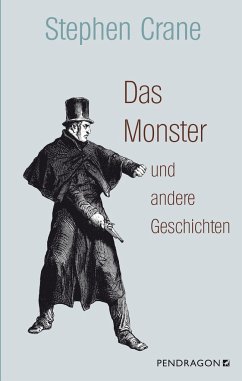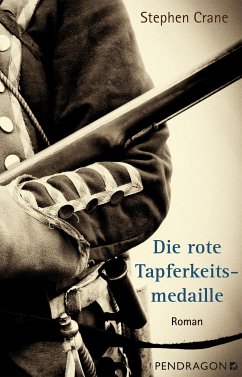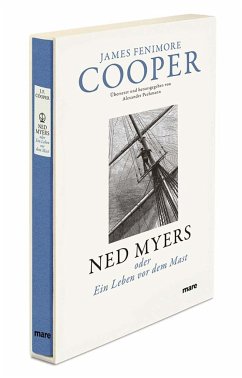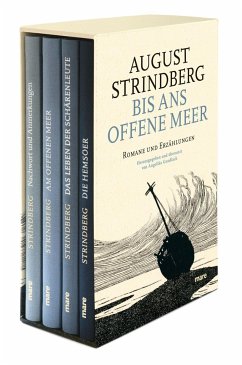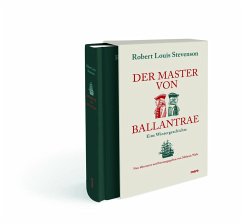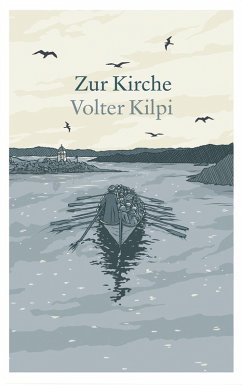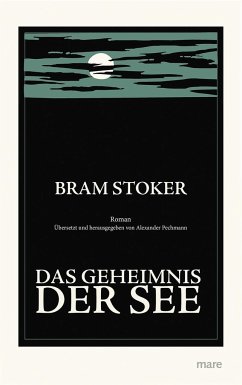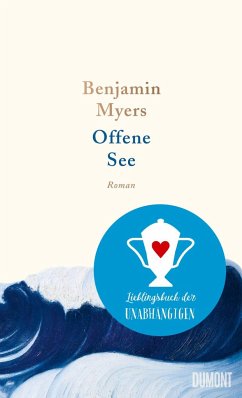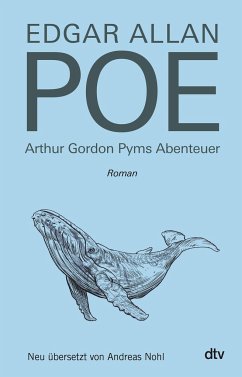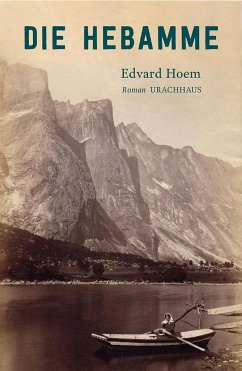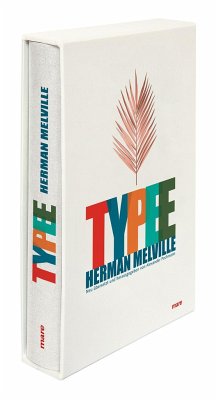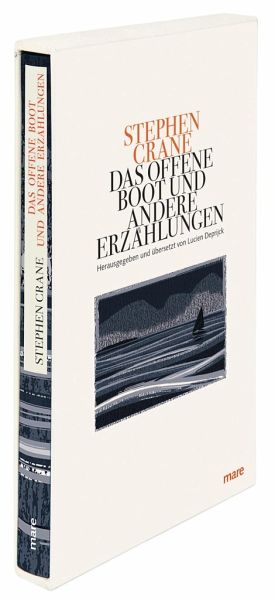
Das offene Boot und andere Erzählungen
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
26,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Stephen Crane war ein Getriebener, er lebte ein Leben unter Hochdruck, als hätte er geahnt, dass ihm nur wenig Zeit bemessen war. Geboren 1871 in Newark, New Jersey, starb er nur achtundzwanzigjährig an Tuberkulose, dieer sich vermutlich als Schiffbrüchiger nach dem Untergang der Commodore zugezogen hatte - eine Erfahrung, deren literarische Verarbeitung seinen Ruhm als Erzähler begründen sollte.Kritiker sahen in Crane durch seine intensiven Milieustudien und die Nähe zur Reportage den ersten amerikanischen Naturalisten, doch weist der Autor mit seinen Stilbrüchen, der rhythmisierten Sp...
Stephen Crane war ein Getriebener, er lebte ein Leben unter Hochdruck, als hätte er geahnt, dass ihm nur wenig Zeit bemessen war. Geboren 1871 in Newark, New Jersey, starb er nur achtundzwanzigjährig an Tuberkulose, die
er sich vermutlich als Schiffbrüchiger nach dem Untergang der Commodore zugezogen hatte - eine Erfahrung, deren literarische Verarbeitung seinen Ruhm als Erzähler begründen sollte.
Kritiker sahen in Crane durch seine intensiven Milieustudien und die Nähe zur Reportage den ersten amerikanischen Naturalisten, doch weist der Autor mit seinen Stilbrüchen, der rhythmisierten Sprache und den geradezu filmischen Dialogen eher ins 20. Jahrhundert, zu Faulkner und Joyce.
Hier nun sind Stephen Cranes stärkste (Meeres-)Erzählungen vereint - größten- teils erstmals auf Deutsch. Sie laden ein, diesen noch viel zu wenig bekannten Pionier der nordamerikanischen Moderne (neu) zu entdecken.
er sich vermutlich als Schiffbrüchiger nach dem Untergang der Commodore zugezogen hatte - eine Erfahrung, deren literarische Verarbeitung seinen Ruhm als Erzähler begründen sollte.
Kritiker sahen in Crane durch seine intensiven Milieustudien und die Nähe zur Reportage den ersten amerikanischen Naturalisten, doch weist der Autor mit seinen Stilbrüchen, der rhythmisierten Sprache und den geradezu filmischen Dialogen eher ins 20. Jahrhundert, zu Faulkner und Joyce.
Hier nun sind Stephen Cranes stärkste (Meeres-)Erzählungen vereint - größten- teils erstmals auf Deutsch. Sie laden ein, diesen noch viel zu wenig bekannten Pionier der nordamerikanischen Moderne (neu) zu entdecken.