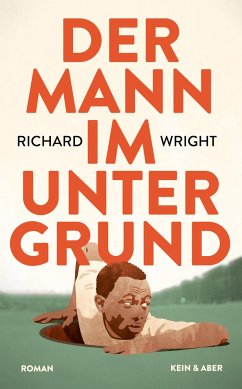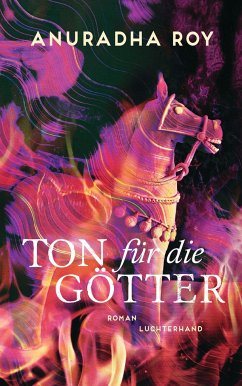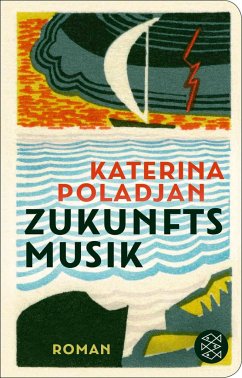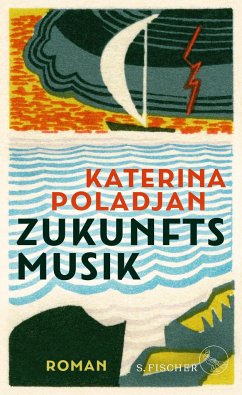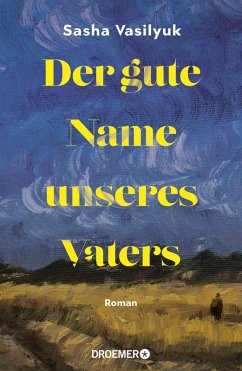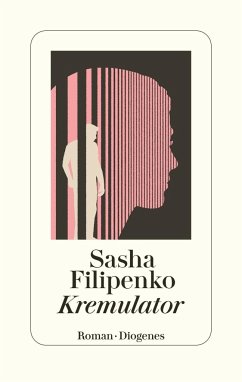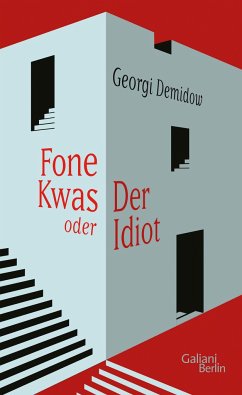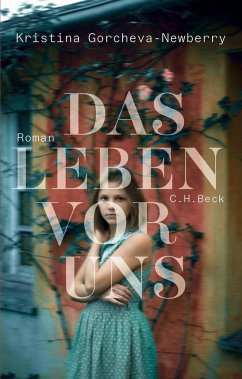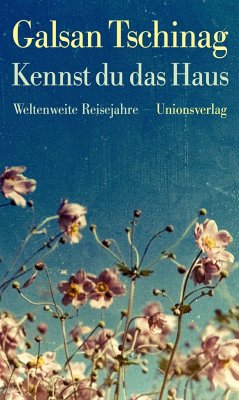-51%12)

Valery Tscheplanowa
Gebundenes Buch
Das Pferd im Brunnen (Mängelexemplar)
'Eine wunderschöne, poetische Sprache ... ein Buch, das zu lesen sich lohnt.' Elke Heidenreich, WDR
Sofort lieferbar
Gebundener Preis: 22,00 € **
Als Mängelexemplar:
Als Mängelexemplar:
**Frühere Preisbindung aufgehoben
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
5 °P sammeln!
Minimale äußerliche Macken und Stempel, einwandfreies Innenleben. Schnell sein! Nur begrenzt verfügbar.





Alles beginnt in einer kleinen Wohnung mit Schaukelstuhl in einem russischen Kurort bei Kasan, in dem einst Stalin seine Sommer verbrachte. Hierhin kehrt Walja nach dem Tod ihrer Großmutter Nina zurück. Walja begibt sich auf Spurensuche, versucht zu verstehen, wo sie selbst herkommt. Sie erinnert sich an die Frauen, mit denen sie aufwuchs, grundverschieden, aber einig in ihrer Abscheu gegen jede Abhängigkeit: Da ist die Urgroßmutter Tanja, die Walja als Kind in einer gefährlichen Nacht-und-Nebel-Aktion taufen ließ. Und natürlich Nina mit dem zielstrebigen Gang und dem koketten Kirschmun...
Alles beginnt in einer kleinen Wohnung mit Schaukelstuhl in einem russischen Kurort bei Kasan, in dem einst Stalin seine Sommer verbrachte. Hierhin kehrt Walja nach dem Tod ihrer Großmutter Nina zurück. Walja begibt sich auf Spurensuche, versucht zu verstehen, wo sie selbst herkommt. Sie erinnert sich an die Frauen, mit denen sie aufwuchs, grundverschieden, aber einig in ihrer Abscheu gegen jede Abhängigkeit: Da ist die Urgroßmutter Tanja, die Walja als Kind in einer gefährlichen Nacht-und-Nebel-Aktion taufen ließ. Und natürlich Nina mit dem zielstrebigen Gang und dem koketten Kirschmund, die notorisch log und alle um sie herum einen Kopf kleiner werden ließ. Doch sie hatte auch ganz andere Seiten. Und erst viel später erfährt Walja von Ninas hartem Schicksal, von dem sie nie sprach ... Walja, die zwischen den Welten lebt, zwischen einem norddeutschen Dorf an der B77 und der Wohnung ihrer Kindheit in Kasan, erkennt immer mehr, wie tief sie diese Leben geprägt haben.
Valery Tscheplanowa ist eine starke neue Stimme. In ihrem autobiographisch inspirierten Roman findet sie ihre ganz eigene leuchtende, bildstarke Erzählweise, intensive Momentaufnahmen fügen sich zu einer großen Geschichte über vier starke Frauen im Russland des 20. und 21. Jahrhunderts.
Valery Tscheplanowa ist eine starke neue Stimme. In ihrem autobiographisch inspirierten Roman findet sie ihre ganz eigene leuchtende, bildstarke Erzählweise, intensive Momentaufnahmen fügen sich zu einer großen Geschichte über vier starke Frauen im Russland des 20. und 21. Jahrhunderts.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Valery Tscheplanowa ist als Schauspielerin an den wichtigsten deutschen Bühnen zu sehen, sie tritt in Kino- und Fernsehfilmen auf und wurde als Buhlschaft im 'Jedermann' der Salzburger Festspiele gefeiert. Sie wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Kunstpreis Berlin und als Schauspielerin des Jahres 2017. Geboren 1980 im sowjetischen Kasan, kam sie mit acht Jahren nach Deutschland. Über ihren ersten Roman, 'Das Pferd im Brunnen', schrieb die 'Süddeutsche Zeitung': 'Tscheplanowas Debüt ist nicht weniger Ereignis als ihr Spiel - roh, durchscheinend, kristallklar und mit einer kühlen Strenge, die sie seltsam weise wirken lässt. Wunderbar.' Valery Tscheplanowa lebt in Berlin.
Produktdetails
- Verlag: Rowohlt, Berlin
- 3. Aufl.
- Seitenzahl: 192
- Erscheinungstermin: 15. August 2023
- Deutsch
- Abmessung: 206mm x 129mm x 21mm
- Gewicht: 275g
- ISBN-13: 9783737101844
- ISBN-10: 3737101841
- Artikelnr.: 70515164
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Rezensentin Christiane Lutz ist vom Erstlingswerk der Schauspielerin Valery Tscheplanowa beeindruckt. Ihr gelingt das "Changieren zwischen dem Konkreten und Abstrakten" mit einer "kargen" aber sehr treffenden Sprache - Tscheplanowa erzählt auf interessante Weise und anhand von einzelnen zusammenhangslosen Episoden vom Alltag einer russischen Familiengeschichte, die vier Generationen umfasst, schreibt Lutz. Es beginnt mit Tanja und ihrer Tochter Nena, die im Sowjetkommunismus leben, in dem jede Form von Individualität bestraft wird, lesen wir. Lena, die Tochter Nenas, siedelt nach einer Romanze mit einem Kriegsveteranen nach Deutschland über, wo ihre Tochter selbstverständlich eine Universität besucht, doch den Bezug zu ihren Vorfahren, und somit dem russischen Kasan, nicht verliert. Die großen Veränderungen in der Politik scheint das Leben der Menschen kaum zu berühren, Glück entsteht beim Pflücken, Einwecken und Grießbrei kochen, bemerkt Lutz. Dass dies ein Debütroman ist, mag die Rezensentin kaum glauben, so "eigen" findet sie den Ton der Autorin.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
Ein "Glanzstück" nennt Rezensentin Undine Fuchs Valery Tscheplanowas Generationenroman, indem die in Russland geborene Autorin von "den Schwächen der Frauen" einer Familie erzählt, "ohne sie zu verraten". Glanzvoll daran ist vieles, lesen wir, zum Beispiel die Form, die Tscheplanowa für ihre Erzählung gewählt hat: Sie erinnert an ein Mosaik - das aus Fragmenten zusammengesetzte, komplexe Bild einer Familie, in dem die Brüche für die vielen Konflikte, die Enttäuschungen, Verletzungen, und all die Auf-, An- und Umbrüche in den Lebensläufen der Frauen stehen können. Diese Umbrüche sind nicht selten bedingt durch politische und gesellschaftliche Umbrüche in ihrer Heimat Russland, lesen wir. Auf diese Weise verwebt Tscheplanowa elegant die individuellen Schicksale mit der Geschichte des Landes. Brillant ist aber auch die Sprache dieser Autorin: direkt, hart, klarsichtig, und zugleich doch voller Sanftmut, Empathie und voller Taktgefühl - im zweifachen Wortsinn, so die hingerissene Rezensentin.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Valery Tscheplanowa ertastet [die Träume] unter dem Staub der Zeiten. Das macht dieses Buch so besonders: wie das eigentlich Triste, Banale zu leuchten beginnt. Man sehnt sich danach, mehr von ihr zu lesen. der Freitag
Gebundenes Buch
Walja wurde in der Sowjetunion geboren und kam mit acht Jahren nach Deutschland. Nun kommt sie nach Jahrzehnten zurück in das Haus ihrer verstorbenen Großmutter Nina, um zu ihren Wurzeln zu finden. Wir begleiten sie dabei und lernen Nina und andere Familienmitglieder kennen.
Alle Frauen …
Mehr
Walja wurde in der Sowjetunion geboren und kam mit acht Jahren nach Deutschland. Nun kommt sie nach Jahrzehnten zurück in das Haus ihrer verstorbenen Großmutter Nina, um zu ihren Wurzeln zu finden. Wir begleiten sie dabei und lernen Nina und andere Familienmitglieder kennen.
Alle Frauen der Familie waren unterschiedlich und doch in ihrer Stärke und dem Bestreben, von niemandem abhängig zu sein, sich sehr ähnlich. Hauptsächlich geht es um Nina, in der sich Walja wiederfindet. Walja mit ihrem Kirschmund und den kleinen spitzen Zähnen legte Wert auf ihr Aussehen. Sie war eine harte Frau und eine notorische Lügnerin und wusste sich durchzusetzen. Obwohl sie nicht besonders groß war, schienen alle kleiner zu werden, sobald sie den Raum betrat. Anderen Kindern und Tieren gegenüber kann sie Zuneigung zeigen, ihre eigenen Kinder werden versorgt und müssen ohne Zärtlichkeit auskommen. Erst spät erfährt Walja von Ninas hartem Schicksal, über das sie nie gesprochen hat. Aber auch für ihre Urgroßmutter Tanja und Waljas Mutter Nina ist das Leben kein Zuckerschlecken.
Die Autorin Valery Tscheplanowa erzählt in klarer Sprache, nicht chronologisch und in kleinen Episoden, die sich erst mit der Zeit zusammenfügen. Vieles wird nur angedeutet, manches lässt sich nur erahnen. Das Leben ist hart und die jeweiligen politischen Systeme zwingen die Menschen dazu, immer wieder mit veränderten Umständen zurechtzukommen.
Ein beeindruckender Roman über starke Frauen, die ein schweres Leben in Russland haben.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
„Das Pferd im Brunnen“ ist ein Roman mit autobiographischem hintergrund der Autorin Valery Tscheplanowa. Dabei dreht sich die Geschichte um Walja und die drei für sie wichtigste Frauen: Urgroßmutter Tanja, Großmutter Nina und der Mutter Lena. Es beginnt mit einem …
Mehr
„Das Pferd im Brunnen“ ist ein Roman mit autobiographischem hintergrund der Autorin Valery Tscheplanowa. Dabei dreht sich die Geschichte um Walja und die drei für sie wichtigste Frauen: Urgroßmutter Tanja, Großmutter Nina und der Mutter Lena. Es beginnt mit einem Rückblick auf ihre eigene Kindheit und das damalige Leben in Russland. Zu Beginn war ich begeistert von der Atmosphäre und konnte mich richtig in die Zeit hineinversetzen. Im weiteren Verlauf musste ich aber feststellen, dass ich inzwischen gedanklich aus dem Roman und seinen Geschehnissen ausgestiegen war und nicht mehr hineinkam.
Dies erkläre ich mir damit, dass die Handlung zwischen den einzelnen Frauen und auch zwischen den verschiedenen Zeitebenen hin und her springt, was für mich etwas verwirrend war. Zwar sind die vier Frauen und ihre Geschichten eindrucksvoll, aber irgendwie gelang es nicht, jede Protagonistin herausstechen zu lassen, da durch die Zeit- und Erzählsprünge die Grenzen zwischen den Charakteren verschwimmen. Diese Sprünge habe ich als anstrengend empfunden, wodurch ich leider keine richtige Verbindung zu den Protagonistinnen aufbauen konnte. Dies wurde noch durch den nüchternen und wenig emotionalen Schreibstil noch verstärkt.
Die Geschichte ist eine spannende, aber es waren für mich zu viel Unruhe und zu wenig Emotionen drin, um wirklich in diese Welt eintauchen zu können.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Poesie und Lebensgeschichte. Ein Buch, welches man kaum nacherzählen kann, wirkt doch jede einzelne Zeile wichtig, jeder einzelne Satz notwendig, jede Beschreibung, jede Geschichte in der Geschichte als ein Teil eines großen Ganzen und unbedingt und genau so zwischen die Buchdeckel …
Mehr
Poesie und Lebensgeschichte. Ein Buch, welches man kaum nacherzählen kann, wirkt doch jede einzelne Zeile wichtig, jeder einzelne Satz notwendig, jede Beschreibung, jede Geschichte in der Geschichte als ein Teil eines großen Ganzen und unbedingt und genau so zwischen die Buchdeckel gehörig, um die wunderbare Verknüpfung von Poesie und Lebensgeschichte herzustellen, wie sie Valery Tscheplanowa in ihrem ersten Roman "Das Pferd im Brunnen" gelungen ist. "Unsere Haut ist eine Geschichte" sagt die Autorin gegen Ende des Romans und lässt ihre Protagonistin Walja auf den letzten Seiten in den Spiegel blicken und die Großmutter im eigenen Gesicht entdecken. So ist der Tod der Großmutter Nina für Walja der Impuls für eine Spurensuche. 'Glück ist eine Tätigkeit' (und kein Zustand) - das ist eine von Ninas Weisheiten; Nina mit ihrem harten und dennoch nicht freudlosen Leben, die sich selbst ins Krankenhaus einweist, weil sie ihr Ende nahen spürt, die noch einmal ihr 'verschmitztes Goldzahnlächeln' lächelt, sich im Krankenbett noch Spiegel, Kamm und Lippenstift kommen lässt, um in Würde zu gehen... Atmosphärisch ungeheuer dicht... und eine Ermutigung, nachdem das Buch zuende gelesen ist, sich selbst auf die Suche zu begeben und Spuren des Lebens der Vorgängergenerationen im eigenen Leben zu entdecken.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Lebenszyklen
Alles verläuft zyklisch in der Welt von Das Pferd im Brunnen. Der Morgen geht in den Abend über, es wird geboren und getauft und am Ende bettet man das Haupt auf jenem Totenkissen, für welches man über Jahre hinweg die Haare vom eigenen Haupt gesammelt hat. Valery …
Mehr
Lebenszyklen
Alles verläuft zyklisch in der Welt von Das Pferd im Brunnen. Der Morgen geht in den Abend über, es wird geboren und getauft und am Ende bettet man das Haupt auf jenem Totenkissen, für welches man über Jahre hinweg die Haare vom eigenen Haupt gesammelt hat. Valery Tscheplanowa beschreibt all dies mit unaufgeregter Gelassenheit, die für uns der Schlüssel ist in eine Welt, die in diesem Land nur wenige mit eigenen Augen gesehen haben.
Im Zentrum der Erzählung steht Nina, ihre Großmutter. Sie ist ebenso resolut wie sensibel. Auf ihren strammen Fesseln schreitet sie durchs Leben, von den Lehmstraßen ihres Dorfes bis in die große Stadt. Sie ist ebenso erbarmungslos wie sanft. Ihren Sohn straft sie mit Missachtung, während sie ein verletztes Kätzchen liebevoll gesund pflegt, nur um es im nächsten Moment wieder vor die Tür zu setzen. Facetten setzen sich in ihr wie Mosaiksteinchen zu einem großen Ganzen zusammen und ergeben am Ende ein komplexes Bild voller Widersprüche.
Valery Tscheplanowa entwirft Szenerien, die nicht mehr loslassen. In klaren Worten beschreibt sie einmal den eigenen Tod, wie sie ihn sich vorstellt: Vom Nierenversagen, welches das Wasser in die Lungen treibt, über den Herzstillstand bis hin zum Hirntod, auf den langsam aber sicher die Zersetzung aller Körperzellen folgt. Abgeschreckt und fasziniert fragt man sich, wie jemand mit solcher Detailverliebtheit den eigenen Tod, den Tod eines jeden Menschen, vor Augen haben kann und es packt einen die Ehrfurcht vor dieser Autorin, die nicht einmal Themen scheut, vor denen sich ein Großteil der Menschheit sein Leben lang drückt.
Das Pferd im Brunnen besticht mit Intimität, die persönliche Wahrnehmung atmet in jeder einzelnen Seite. Ohne zu verklären, lässt er die Welt des Sozialismus erstehen, wie ihn die Menschen gelebt haben und wird damit zu einem Roman, der heutzutage wichtiger ist denn je.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Glück ist eine Tätigkeit
Schon äußerlich gefällt mir das Buch sehr gut. Der feste Einband, das schöne Gemälde auf dem Schutzumschlag und die gewählten Farben für Einband, Vorsatzblatt und Lesebändchen machen das Buch zu etwas …
Mehr
Glück ist eine Tätigkeit
Schon äußerlich gefällt mir das Buch sehr gut. Der feste Einband, das schöne Gemälde auf dem Schutzumschlag und die gewählten Farben für Einband, Vorsatzblatt und Lesebändchen machen das Buch zu etwas Besonderem.
Großmutter Tanja, Mutter Nina, Tochter Lena und Enkelin Wanja sind die Protagonistinnen.
Erzählt werden viele kleine Geschichten dieser vier Generationen russischer Frauen, die aus einem kleinen Ort nahe Kasan stammen. Diese Geschichten erscheinen mir wie eine Schachtel voller unsortierter alter Fotos. Erzählt wird von den harten und kargen Leben der Frauen, die stets auf sich allein gestellt sind und nach Unterstützung und Beistand gar nicht erst fragen. Jede auf ihre spezielle Art macht einfach immer wieder aus dem, was das Leben ihr zumutet, das Bestmögliche. Das Überleben beherrschen die Frauen wirklich gut. Die Männer spielen eher die Nebenrollen. Aus verschiedenen Gründen etabliert sich kein Mann als verlässlicher Partner, mit dem man durch Dick und Dünn gehen kann.
Es ergibt sich ein schwermütiges und kraftvolles Gesamtbild, durch das die russische Seele sehr klar hindurchklingt.
Ich mag dieses Buch sehr und gebe eine klare Leseempfehlung.
Weniger
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Die Autorin hat russische Vorfahren und eine deutsche Kindheit - wer besser kann uns die Seele der russischen Frauen erklären? Mit Sprachbildern wie "im Frühling pflückt sie frische Brennnesseln mit diesen Händen" fühlt man sich sofort hinein in die sowjetische …
Mehr
Die Autorin hat russische Vorfahren und eine deutsche Kindheit - wer besser kann uns die Seele der russischen Frauen erklären? Mit Sprachbildern wie "im Frühling pflückt sie frische Brennnesseln mit diesen Händen" fühlt man sich sofort hinein in die sowjetische Welt. Frauen sind die Hauptpersonen dieses Buches, wunderbar. Die einzelnen Geschichten der verschiedenen Familienmitglieder sind nur lose verbunden, aber sie zeichnen insgesamt ein beeindruckendes Sittenbild, nichts wird beschönigt. Manchmal hätte ich mir etwas "Gutes", etwas "Warmherziges" gewünscht, so hinterlässt das Buch leider einen traurigeren Eindruck, als das warmfarbene Cover verspricht.
Das Cover ist wunderschön und hat mich sofort angesprochen.
Hoffentlich gibt es bald wieder eine Buch von der Autorin, vielleicht über die "Deutschrussen" ?
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Die Geschichte ist teilweise autobiografisch erzählt und handelt um 4 Frauen aus Russland bzw. mit russischen Wurzeln aus einer Familie, die allesamt ihre eigenen Probleme etc. zu bewältigen haben und auf Spurensuche ihrer Wurzeln bzw. ihrer Familie nachgehen.
Ich fand es literarisch …
Mehr
Die Geschichte ist teilweise autobiografisch erzählt und handelt um 4 Frauen aus Russland bzw. mit russischen Wurzeln aus einer Familie, die allesamt ihre eigenen Probleme etc. zu bewältigen haben und auf Spurensuche ihrer Wurzeln bzw. ihrer Familie nachgehen.
Ich fand es literarisch wunderbar erzählt, die Figuren waren allesamt sehr interessant und lebhaft beschrieben. Auch fand ich die Charaktere sehr facettenreich und vor allem unter dem Aspekt der Generationen sehr interessant. Alles in allem ein tolles Buch mit einer Geschichte mal aus einer anderen Perspektive bzw. Kultur. Da es ein recht kurzes Buch ist, kommt man auch sehr schnell durch und es ist aber auch an keiner Stelle langweilig oder stockend und man erfährt auch viel über das russische Alltagsleben und ihre Kultur, was ich auch sehr spannend zu lesen fand.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
In "Das Pferd im Brunnen" berichtet Valery Tscheplanowa episodenhaft aus vier Generationen Familien- und Frauenleben. Die Frauen der Familie - allen voran die Urgroßmutter und die Großmutter - trotzen dem Sowjet-Kommunismus und den anderen Beschwerlichkeiten des Lebens, packen …
Mehr
In "Das Pferd im Brunnen" berichtet Valery Tscheplanowa episodenhaft aus vier Generationen Familien- und Frauenleben. Die Frauen der Familie - allen voran die Urgroßmutter und die Großmutter - trotzen dem Sowjet-Kommunismus und den anderen Beschwerlichkeiten des Lebens, packen ohne lange zu zaudern an, um sich und die Familie durch zu bringen. Männer sind hier nur kurze Nebendarsteller und glänzen eher durch Abwesenheit. Wir lernen die Frauen in den einzelnen Momentaufnahmen gut kennen; erfahren neben ihrer Tatkräftigkeit auch von (meist unerfüllt bleibenden) Chancen und Träumen, Konflikten und Schuld. Ein intimer Einblick in diese Leben. Das ganze sehr bildhaft mit nie langweilig werdenden Detailbeschreibungen.
Ich fand das Buch in seiner Sprunghaftigkeit zwischendurch durchaus fordernd. Manchmal verschwommen die Generationen und die zwei Wohnungen. Zwischen den Momentaufnahmen bleibt vieles ungesagt, was aber auch ok ist.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Walja erzählt uns in diesem Roman die Geschichte ihrer Vorfahrinnen, der Urgroßmutter Tanja, der Großmutter Nina und der Mutter Lena, die allesamt unabhängig und oft auch auf sich alleine gestellt das Leben stemmen mussten, welches nicht immer gut zu ihnen war. Sie alle lebten …
Mehr
Walja erzählt uns in diesem Roman die Geschichte ihrer Vorfahrinnen, der Urgroßmutter Tanja, der Großmutter Nina und der Mutter Lena, die allesamt unabhängig und oft auch auf sich alleine gestellt das Leben stemmen mussten, welches nicht immer gut zu ihnen war. Sie alle lebten zu großen Teilen ihres Lebens in der ehemaligen Sowjetunion, doch Walja verbrachte den Großteil ihres Lebens in Norddeutschland und versucht nun auf den Spuren ihrer weiblichen Familienmitglieder zu wandeln und mehr über die Vergangenheit und auch sich selbst zu erfahren.
Die Autorin lässt uns in diesem Roman zum Teil an ihrer eigenen Geschichte teilhaben, was die Lektüre umso spannender macht. Sie hat einen wundervoll besonderen Schreibstil, der irgendwie derb, aber irgendwie auch zutiefst poetisch ist. Womit ich nicht immer gut klar kam war, dass die Geschichte nicht einfach chronologisch erzählt wird, sondern jedes Kapitel mehr oder weniger für sich steht und wild zwischen den verschiedenen Zeiten und den einzelnen Leben der Frauen umher gesprungen wird. Am Ende ergeben die einzelnen Puzzleteile zwar schon ein großes Ganzes, mir persönlich ist dadurch aber glaube ich die eine oder andere Information abhanden gekommen.
Eine interessant erzählte Geschichte ist es jedoch allemal und man bekommt sehr persönliche Einblicke in das Leben in der ehemaligen Sowjetunion bzw. wie sich dieses angefühlt haben dürfte.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Intensiv
Das Pferd im Brunnen war mein allererster Roman von der Autorin Valery Tscheplanowa, weshalb ich mir sehr unsicher war, was mich erwarten würde, bevor ich mit dem Lesen begonnen habe. Vom Titel lässt sich jedenfalls auch nicht viel ableiten, das Cover immerhin ist in meinen Augen …
Mehr
Intensiv
Das Pferd im Brunnen war mein allererster Roman von der Autorin Valery Tscheplanowa, weshalb ich mir sehr unsicher war, was mich erwarten würde, bevor ich mit dem Lesen begonnen habe. Vom Titel lässt sich jedenfalls auch nicht viel ableiten, das Cover immerhin ist in meinen Augen schön gestaltet. Im Buch findet sich die Reise der Hauptprotagonistin Walja - auf der Suche nach den Spuren ihrer Familie, Kindheit und damaligen Weggenossen. Während die Suche immer tiefer und tiefer geht, wird man als LeserIn auch immer weiter in das Schicksal der Protagonistin mitgenommen. Das wird zeitgleich auch immer intensiver - kommen doch immer mehr Details ans Licht, über die selbst Walja bislang noch nichts wusste. Dies ist zwar sehr eindrücklich geschildert, zieht sich allerdings recht lang. Das typische Spurensuche-herausfinden über die eigene Person findet sich hier wieder - wenn auch nicht sehr originell.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für