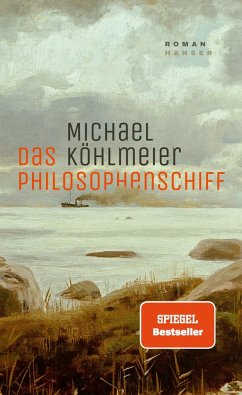Eine beinahe wahre Geschichte vom "erstklassigen Erzähler Michael Köhlmeier." Denis Scheck, ARD DruckfrischMit diesem großen Werk schließt Michael Köhlmeier an seinen Bestseller "Zwei Herren am Strand" an. Zu ihrem 100. Geburtstag lädt die Architektin Anouk Perleman-Jacob einen Schriftsteller ein und bittet ihn darum, ihr Leben als Roman zu erzählen. In Sankt Petersburg geboren, erlebt sie den bolschewistischen Terror. Zusammen mit anderen Intellektuellen wird sie als junges Mädchen mit ihrer Familie auf einem der sogenannten "Philosophenschiffe" auf Lenins Befehl ins Exil deportiert. Nachdem das Schiff fünf Tage und Nächte lang auf dem Finnischen Meerbusen treibt, wird ein letzter Passagier an Bord gebracht und in die Verbannung geschickt: Es ist Lenin selbst.
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Monika Helfer und Michael Köhlmeier haben fast zeitgleich neue Bücher veröffentlicht, Rezensent Ijoma Mangold nimmt das zum Anlass, das Paar in Hohenems im oberösterreichischen Voralberg zu besuchen und über ihre mehr als vierzigjährige Ehe zu plaudern. Ein paar Worte verliert der Kritiker aber auch über die Bücher der beiden: Köhlmeiers "Philosophenschiff" ist für Mangold nicht weniger als ein "Jahrhundertroman", der ihm einmal mehr die Kunst des Autors vor Augen führt, seinen Romanen eine so "stabile" wie "originelle" Architektur zu geben. Er folgt hier der Geschichte einer jüdisch-russischen Architektin, die einem Schriftsteller von ihren Erlebnissen auf einem von Lenins "Philosophenschiffen" erzählt. Mangold empfiehlt das Buch als einen so fesselnden wie coolen "inquisitorischen" Roman, der die kommunistische Illusion durchleuchte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Historisch inakkurat, aber gut erfunden: Michael Köhlmeier lässt seine vertriebene Heldin im Roman "Das Philosophenschiff" auf Lenin treffen. Der aber gar nicht an Bord gewesen ist.
Er hat es wieder einmal geschafft: Michael Köhlmeiers kürzlich erschienener Roman "Das Philosophenschiff" hat zuverlässig die Bestsellerlisten erstürmt. Damit schließt Köhlmeier direkt an seinen Erfolgstitel "Frankie" aus dem letzten Jahr an. Wenn man ihn danach fragt, wie er es schafft, ein so ungemein produktiver und zugleich erfolgreicher Autor zu sein, verweist er galant auf seine Figuren: Es seien nicht die Ideen, die aus ihm heraussprudeln, sondern vielmehr die Figuren, die "kommen oder nicht kommen. Wenn sie kommen, bringen sie eine Geschichte mit, die erzählen sie mir, und ich schreibe mit." So jedenfalls beschreibt Köhlmeier es im verlagseigenen Interview zu "Frankie".
In exakt diesen Worten resümiert sich zugleich der Aufbau des neuen Romans: Die Hauptfigur, die gefeierte Architektin Anouk Perleman-Jacob, kommt auf den Erzähler zu und bittet ihn, einen Teil ihrer Lebensgeschichte zu erzählen. Diese erzählerische Rahmung ist jedoch nicht nur zu Beginn und Ende des Romans präsent, vielmehr werden fast alle Kapitel von ihr ein- und ausgeleitet und stellen die einzelnen Sitzungen dar, in denen sich der Erzähler und die Architektin unterhalten. Die Gesprächsdynamik der beiden Figuren ist geprägt von Misstrauen und Sympathie zugleich, was sich schon daran ablesen lässt, wie der Erzähler auf das Angebot von Perleman-Jacob reagiert: Zwar teilt er wohl nicht die Empörung seiner Frau ("Alter schütze offenbar nicht vor unzumutbarem Verhalten"), möchte aber eigentlich nicht auf das Angebot eingehen. "Aber am nächsten Tag drückte ich wieder auf den Klingelknopf an der Haustür der Villa in Hietzing. In meiner Tasche hatte ich eine Schachtel Marlboro und mein Handy als Aufnahmegerät." Die Gespräche zwischen den beiden sind gespickt mit kleinen Sticheleien und Schlagabtauschen, aber auch freundschaftlichen Annäherungsversuchen. Man merkt, dass Köhlmeiers Erzählen wie gewohnt einen Fokus auf die Figuren und die Beziehung zwischen ihnen legt.
Daneben bleibt aber auch genug Raum für die Geschichte, die Perleman-Jacob erzählen will beziehungsweise von der sie möchte, dass diese literarisiert wird. Denn das Spiel mit der Fiktion thematisieren die Figuren selbst direkt zu Beginn des Romans: "Was niemand weiß, das sollen Sie schreiben, ein Schriftsteller, dem man nicht glaubt, was er schreibt. Gesagt werden soll es. Und wenn es keiner glaubt, umso besser. Aber erzählt werden soll es." Und das, was sie unbedingt erzählt wissen will, ist die Geschichte der Ausweisung ihrer Familie aus Russland auf einem der sogenannten Philosophenschiffe. Perleman-Jacob erzählt von diesem Ereignis aus dem Jahr 1922, von dem Leben mit ihren Eltern in Sankt Petersburg, dem Verhör durch die Geheimpolizei Tscheka und schließlich der Deportation: Mit nur dem nötigsten Gepäck wurden sie auf ein Dampfturbinenschiff gebracht und exiliert. Die anderen Passagiere: ein Dutzend älterer Ehepaare oder Geschwister, allesamt Intellektuelle, die in den Augen der Bolschewiki eine Gefahr darstellten.
Von dieser ungewöhnlichen Überfahrt erzählt die Architektin nun 86 Jahre später, wobei ihr besonders ein Passagier in Erinnerung geblieben ist: Die Rede ist von Lenin, den sie während ihrer nächtlichen Streifzüge auf dem Oberdeck trifft. Neben den philosophisch-anmutenden Gesprächen zwischen der jugendlichen Anouk und dem Revolutionär, der Millionen Tote in Kauf genommen hat, ist es jedoch hauptsächlich eine andere Frage, die für Spannung sorgt: Warum wurden Perleman-Jacob und ihre Eltern aus Russland ausgewiesen? Den anfänglich sehr vagen Erklärungen einer ungünstigen und eigentlich nur losen Freundschaft mit dem Dichter Nikolai Gumiljow und dem Politiker Boris Sawinkow misstraut der Erzähler, weswegen er parallel zu den Gesprächen mit der Architektin auf eigene Faust recherchiert. Im Laufe des Romans stellt sich heraus, dass sein Misstrauen gerechtfertigt ist und die Gesprächspartnerin ihm etwas vorenthält.
Dieser Spannungsbogen ist durchaus gelungen, wird aber leider teilweise davon unterbrochen, dass Perleman-Jacob in assoziativ-ausufernder Manier erzählt. Vermutlich soll dadurch die Mündlichkeit ihres Berichts unterstrichen und auch schlicht ihr Alter authentisch dargestellt werden, dennoch hätte dafür auch ein etwas weniger anekdotischer Stil ausgereicht.
Doch trotzdem muss man Köhlmeier zugutehalten, dass Rahmen- und Binnenerzählung auf sehr geschickte Weise miteinander verwoben sind und auch die Fiktionalisierung von historischen Gegebenheiten gekonnt ist: Die Philosophenschiffe gab es wirklich, Lenin war jedoch nie Passagier auf einem. Anouk Perleman-Jacob ist ein fiktiver Name, aber Karl-Markus Gauß erwähnt in seiner Rezension des Romans in der "Süddeutschen Zeitung", dass biographische Details auf die Architektin Margarete Schütte-Lihotzky verweisen. Der Erzähler trägt zudem den Namen Michael, weswegen auch die Autofiktion-Sirenen schon angesprungen sind. Die Mischung aus klassischem Erzählen in der Kombination mit dem guten alten (Auto-)Fiktionsspiel sorgt bei Kritikern wie Publikum zielsicher für Begeisterung. Hier fällt das Urteil zwar etwas weniger überschwänglich aus, aber dennoch: Michael Köhlmeier hat mit "Das Philosophenschiff" einen (weiteren) lesenswerten Roman vorgelegt. EMILIA KRÖGER
Michael Köhlmeier: "Das Philosophenschiff". Roman.
Carl Hanser Verlag,
München 2024.
224 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Michael Köhlmeier bannt mit seiner fast hypnotischen Stimme die Zuhörer:innen vom ersten Wort an.«