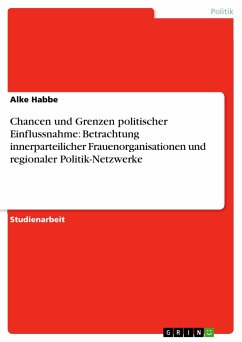»Das interessanteste und informativste Buch über Politik, das ich seit Jahren gelesen habe.« Bill Clinton Seit der Aufklärung gehen wir davon aus, daß Menschen sich bei politischen Entscheidungen in erster Linie von rationalen Kosten-Nutzen-Kalkulationen leiten lassen. Der Psychologe Drew Westen stellte diese Überzeugung mit einer Reihe spektakulärer Experimente in Frage. Er konnte zeigen, daß Emotionen, etwa vor Wahlen, eine mindestens ebenso wichtige Rolle spielen. Diesen Gedanken entfaltet Westen anhand zahlreicher Beispiele aus der jüngeren US-Wahlkampfgeschichte in seinem Buch »Das politische Gehirn«; auch hierzulande wächst seitdem in Politik und Wissenschaft das Interesse an der Bedeutung der Emotionen. Die deutsche Ausgabe enthält neben den zentralen Kapiteln des US-Bestsellers ein ausführliches Interview, in dem Westen sich mit der Kritik an seinem Ansatz, mit der Politik Barack Obamas und der Situation in anderen Ländern auseinandersetzt.

Die Tatsache, dass die amerikanischen Bürger bei der bevorstehenden Präsidentenwahl sich zum größten Teil schon vor dem Wahlkampf für einen Kandidaten entschieden haben, ist keine Neuigkeit. Schließlich gibt es nur deshalb die swing states, auf die der Wahlkampf sich konzentriert, weil in ihnen die Minderheit von vermutlichen Wechselwählern den Ausschlag gibt. Für die Mehrheit der amerikanischen Wähler, ungefähr achtzig Prozent, gilt dagegen, dass sie sich von keinen Argumenten, Debatten oder Attacken in ihrer tiefsitzenden Neigung zu einem der beiden Kandidaten der großen Parteien verunsichern lassen.
Es ist dieser bekannte Sachverhalt, an dem Drew Westen in seinem ursprünglich 2007 erschienenen und nun auch auf Deutsch vorliegenden Buch ansetzt (Drew Westen: "Das politische Gehirn". Aus dem Englischen von Niklas Hofmann. Suhrkamp Verlag, Berlin 2012. 183 S., br., 15,50 [Euro]). Nicht etwa, um das Wählerverhalten noch einmal soziologisch zu durchleuchten, sondern um eine grundsätzlichere Lektion anzubringen. Nämlich den Hinweis darauf, dass die Wähler sich nicht zu einer rationalen Entscheidung durchrechnen, die ihre einsehbaren Präferenzen mit den richtigen Gewichtungen einbringt, sondern Sympathien und Gefühlen - aus ihrer objektiven sozialen Position gar nicht richtig ableitbare Bekenntnisse zu bestimmten Werten eingeschlossen - nachgeben.
Drew Westen hält diese Einsicht für bahnbrechend. Was sie natürlich nicht mehr ist, selbst wenn wirklich gelten sollte, wie er nahelegt, dass die Demokraten in intellektuellem Übermut häufiger dazu neigen, die Ansprache der Gefühle der Bürger nicht nachdrücklich genug zu üben. Aber dass Gefühle und "unvernünftige" Wertentscheidungen in der Wählerschaft eine Rolle spielen, das muss man wirklich nicht noch einmal herbeten.
Wäre da nicht noch die Wendung zum Gehirn. Sie verspricht anscheinend immer noch - oder versprach zumindest noch vor fünf Jahren - wohletablierte psychologische Einsichten in neuem Licht erscheinen zu lassen. Nicht von Wählern ist deshalb über weite Strecken bei Westen die Rede, sondern von Gehirnen. Nicht prospektive Wähler kommen in Schwierigkeiten, wenn sie über widersprüchliche Aussagen und Schwächen ihrer bevorzugten Kandidaten hinwegturnen, sondern Gehirne. Nicht von Wertorientierungen oder Gefühlen muss zuletzt geredet werden, sondern von neuronalen Schaltkreisen und von der Amygdala.
Der Mehrwert, der sich daraus für das Studium des Wählerverhaltens ergibt, ist einfach resümiert: Er liegt nahe bei null. Gleichzeitig fällt einem eigentlich nur diese Wendung zum Gehirn als möglicher Grund dafür ein, dass der Band in Suhrkamps "edition unseld" aufgenommen wurde, die sich ja vor allem der Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlich und technologisch angetriebenen Veränderungen unseres Selbst-, Welt- und Gesellschaftsbilds widmet. Ein klare Kontur mag da nicht immer leicht zu erreichen sein. Aber von der Maxime, das Auftreten von Gehirn-Scannern als Indikator für die Reihentauglichkeit zu verwenden, möchte man doch eher abraten.
HELMUT MAYER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main