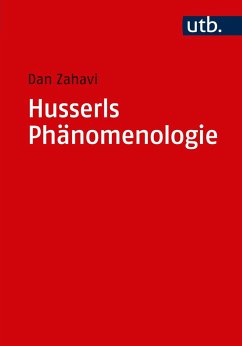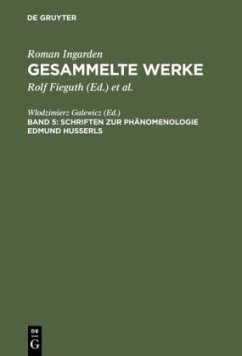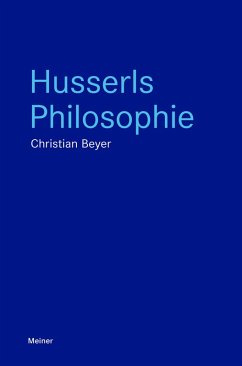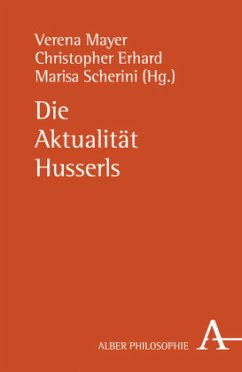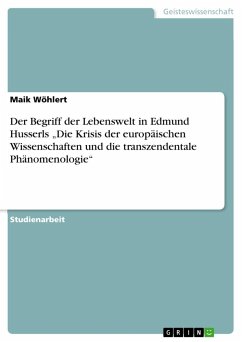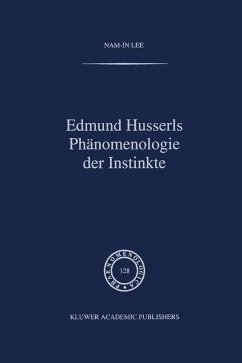historischen und psychologischen Spielart sucht Husserl zu zeigen, dass die Gesetze der Logik und die Prinzipien der Philosophie von aller Erfahrung unabhängig sind. Insbesondere können sie wegen ihrer Absolutheit keine Genese haben, also nicht Ergebnisse von Prozessen sein, in denen sie sich erst entwickelt hätten.
War also die Phänomenologie anfangs noch jedem Entwicklungsgedanken abhold, so hat Husserl in seinen späteren Jahren dennoch eine "genetische Phänomenologie" konzipiert. Schon der Titel schien ein Widerspruch in sich zu sein. Und die neu geprägten Begriffe wie "transzendentale Erfahrung" und "transzendentale Geschichte" verstehen sich ja auch nicht gerade von selbst. Das ist fortan Husserls Leitgedanke: Alles, was absolut gültig ist, muss eine besondere Weise des Sich-Entwickelns haben, eine ganz eigene Art von Geschichte, die diese Gültigkeit nicht nur nicht desavouiert, sondern verständlich macht und begründet. Diesem kühnen, vielleicht allzu kühnen Gedanken geht das vorliegende Buch nach.
Es tut dies, indem es die Frage zu beantworten versucht: Wie hat sich der Gedanke, dass zeitlose Formen eine zeitliche Genese haben, im Philosophieren Husserls selbst herausgebildet? Nicht die intellektuelle Biographie des Theoretikers interessiert den Autor, sondern die Entwicklung der Theorie selbst. Dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Husserls Weg zu einer genetischen Phänomenologie und dem, was in dieser zu erarbeiten wäre, ist dem Verfasser klargeworden. Und so macht er zugleich beides, "das Thema der Genese und die Genese dieses Themas" bei Husserl, zu seinem Thema.
Von den frühen Anläufen bis zu den späten Spekulationen Husserls verfolgt er das Problem. Zöge man alle Husserl-Passagen, die in dieser Arbeit zitiert werden, aus ihr heraus und stellte sie zu einer eigenen Textsammlung zusammen: Eine bessere Anthologie zum Thema Genese im Werk Husserls wäre kaum vorstellbar. Diese Vertrautheit mit dem schwierigen Textbestand ist schon erstaunlich genug. Noch erstaunlicher aber ist - und geradezu fassungslos macht -, dass derselbe Autor kaum eine Ahnung hat von dem, was im Philosophieren Husserls los ist. Er nimmt dessen Darstellungen als fertig abgeschlossene Theoriestücke, um mit ihnen und über ihnen seine denkerische Beweglichkeit und rhetorische Wendigkeit zu exerzieren. Diese Agilität hält er für "Dialektik". Zu beobachten ist aber eine leerlaufende Könnerschaft auf der misslungenen Suche nach dem, woran sie sich bewähren könnte.
"Trotz des äußerst verführerischen Charakters der Erfahrung, zu der Husserl uns einlädt, ist es berechtigt, die Möglichkeit dieser Erfahrung anzuzweifeln." Ein Schlüsselsatz der Autors, sowohl wegen des Motivs der Verführung, vor allem aber wegen der Art des Widerstandes gegen sie. Für Husserl ist die Phänomenologie eine "Philosophie von unten". In ihr sind Begriffe gleichsam abkürzende Merkposten für zugrundeliegende Beschreibungskomplexe. Beschreibungen aber stammen aus der Anschauung und sind wiederum Einladungen und Hinführungen zu ihr. Unser Autor kennt jedoch weder Anschauung noch Beschreibung, nicht fremde und nicht eigene. Er bewegt sich stets oben in der begrifflichen Beletage und in den Stockwerken darüber. Er verwendet Husserls Begriffe vornehmlich zum Knüpfen von Folgerungsketten, zum Nachweis von Widersprüchen und zur Konstruktion logischer Dilemmata, gelegentlich auch als Sprungbrett für eigene Spekulationen. Allenfalls in seiner Behandlung der Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins lässt er ahnen, dass er es auch anders könnte.
Nun aber zu der "Vorbemerkung" des Autors. Hier erfahren wir, dass Jacques Derrida diese Husserl-Studie 1953/54 in Paris als Examensarbeit verfasst hat. Als mittlerweile berühmter Philosoph hat er sie dann 1990 publiziert. Ihm entgeht nicht, wie unzulänglich seine frühe Arbeit ist, und er fragt sich: "Bedurfte es einer Veröffentlichung dieser Schrift?" Ja, lautet seine zögernde Antwort, als ein "Dokument". Aufgefasst als ein Dokument für die Entwicklung des Denkens von Derrida, legt es Fragen dieser Art nahe: Wie kommt es, dass Derrida in späteren Studien zu Husserl den Phänomenologen zwar nicht anschaulicher, aber doch eindringlicher zu interpretieren versteht? Und haben die frühen dialektischen Übungen sich zu jenen neuen und neuartigen Figuren transformiert, die sein Denken so verwirrend für die einen, so faszinierend für die anderen haben werden lassen?
Ein Dokument ist Derridas Schrift auch für den Wandel des Husserl-Bildes. Husserl starb 1938. In den drei Jahrzehnten vor seinem Tod hatte er vor allem Bücher mit einführendem Charakter publiziert. Gar zu oft ließen sie die Beschreibungsfülle, auf der sie aufruhten, nur in Andeutungen und Fragmenten erkennen. Überdies wollte Husserl Haupt einer philosophischen Schule, Lehrer einer strengen Methode und Verfasser eines großen systematischen Werkes sein. All das trug dazu bei, dass in Frankreich wie in Deutschland die Phänomenologie lange Zeit als eine Lehre galt, wenn nicht gar als Doktrin. Kein Wunder, dass sie 1953 dem Pariser Studenten Derrida - seiner genetischen Sicht zum Trotz - wie ein "Gebäude" gegenübersteht; kein Wunder auch, dass er sich freut, es schon im "Wanken" begriffen zu sehen und zu seinem "Einsturz" beitragen zu können.
Sechzig Jahre nach der Niederschrift dessen, was nun auch bei uns als "Dokument" vorliegt, sieht es ganz anders aus. Der seither veröffentlichte handschriftliche Nachlass Husserls übertrifft schon an Umfang das vorher publizierte Werk um ein Vielfaches. Und wir finden kein System und wenig Methode; eher Erkundungsgänge, Höhlenforschungen und Probebohrungen aus den unterschiedlichsten Regionen des Bewusstseins. Das lässt nun auch die alten Werke neu lesen. Auch diesen Wandel zu verdeutlichen, hilft Derridas Dokument. Es ist ein Buch, aus dem man fast nichts lernt, anhand dessen sich dennoch vieles lernen lässt.
MANFRED SOMMER.
Jacques Derrida: "Das Problem der Genese in Husserls Philosophie".
Aus dem Französischen von Johannes Kleinbeck. diaphanes Verlag, Zürich/Berlin 2013. 352 S., br., 34,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.08.2013
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.08.2013