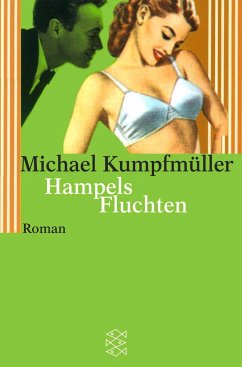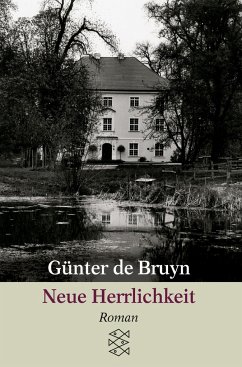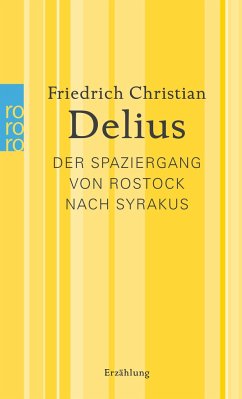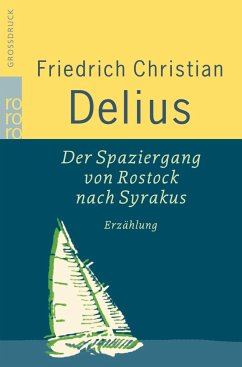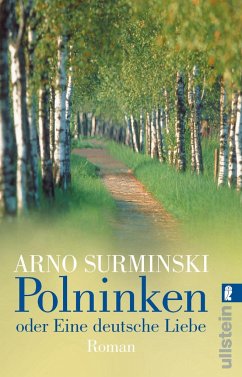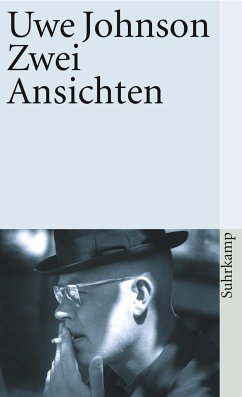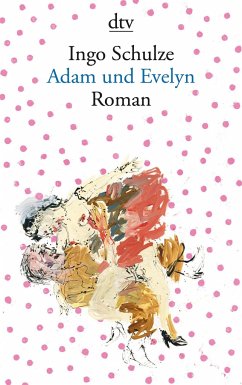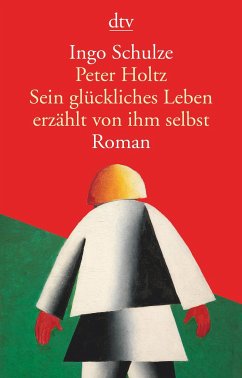Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!




Ein Schriftsteller aus der DDR darf Ende der achtziger Jahre für befristete Zeit in die Bundesrepublik ausreisen. Obwohl ihm der Westen fremd bleibt und sich seine neue Lebensgefährtin wieder von ihm trennt, lässt er den Termin für die Rückkehr verstreichen. Ohne wirklichen Kontakt zur alten Heimat und zur neuen Umgebung verliert er langsam den Boden unter den Füssen
Wolfgang Hilbig, geboren 1941 in Meuselwitz bei Leipzig, gestorben 2007 in Berlin, übersiedelte 1985 aus der DDR in die Bundesrepublik. Er erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen, darunter den Georg-Büchner-Preis, den Ingeborg-Bachmann-Preis, den Bremer Literaturpreis, den Berliner Literaturpreis, den Literaturpreis des Landes Brandenburg, den Lessing-Preis, den Fontane-Preis, den Stadtschreiberpreis von Frankfurt-Bergen-Enkheim, den Peter-Huchel-Preis und den Erwin-Strittmatter-Preis. Im S. Fischer Verlag erscheint die siebenbändige Ausgabe seiner Werke, 'eine der wichtigsten Werkausgaben der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur' (Uwe Schütte, Wiener Zeitung).Wolfgang HilbigWERKEBand I GEDICHTEBand II ERZÄHLUNGEN UND KURZPROSABand III DIE WEIBER - ALTE ABDECKEREI - DIE KUNDE VON DEN BÄUMEN (Erzählungen)Band IV EINE ÜBERTRAGUNG (Roman)Band V 'ICH' (Roman)Band VI DAS PROVISORIUM (Roman)Band VII ESSAYS, REDEN, INTERVIEWSLiteraturpreise:1983 Brüder-Grimm-Preis1985 Förderpreis der Akademie der Künste, Berlin1987 Kranichsteiner Literaturpreis1989 Ingeborg-Bachmann-Preis1992 Berliner Literaturpreis1993 Brandenburgischer Literaturpreis1994 Bremer Literaturpreis1996 Literaturpreis der Deutschen Schillerstiftung, Dresden 1997 Lessingpreis des Freistaates Sachsen1997 Fontane-Preis der Berliner Akademie der Künste1997 Hans-Erich-Nossack-Preis (Kulturkreis d. dt. Wirtschaft)2001 Stadtschreiberpreis von Frankfurt-Bergen-Enkheim2002 Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik2002 Georg-Büchner-Preis2002 Walter-Bauer-Literaturpreis der Stadt Merseburg2007 Erwin-Strittmatter-Preis des Landes Brandenburg
Produktdetails
- Fischer Taschenbücher 15099
- Verlag: FISCHER Taschenbuch / S. Fischer Verlag
- Artikelnr. des Verlages: 1000578
- 4. Aufl.
- Seitenzahl: 320
- Erscheinungstermin: 1. Oktober 2001
- Deutsch
- Abmessung: 190mm x 125mm x 23mm
- Gewicht: 358g
- ISBN-13: 9783596150991
- ISBN-10: 359615099X
- Artikelnr.: 09511731
Herstellerkennzeichnung
FISCHER Taschenbuch
Hedderichstr. 114
60596 Frankfurt
produktsicherheit@fischerverlage.de
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für