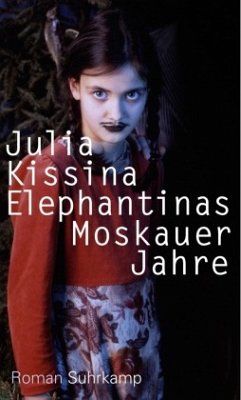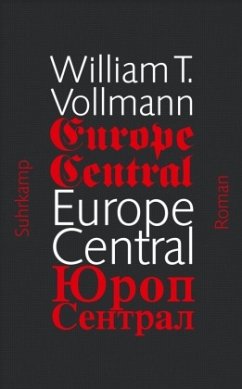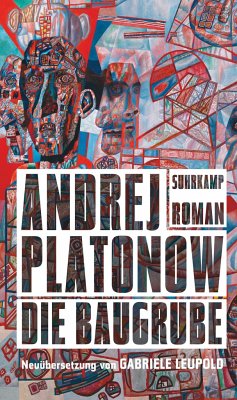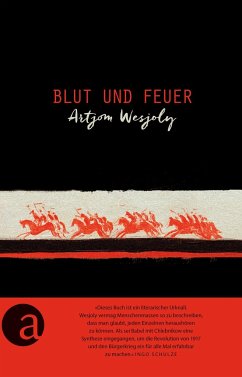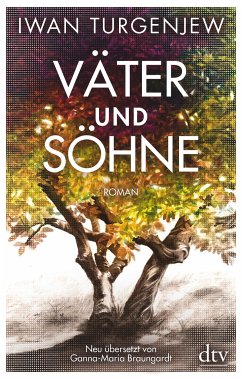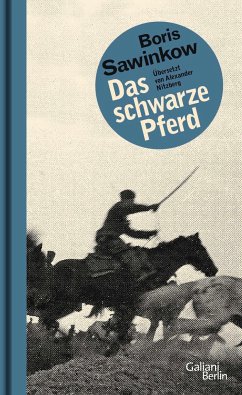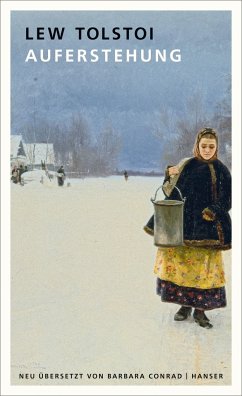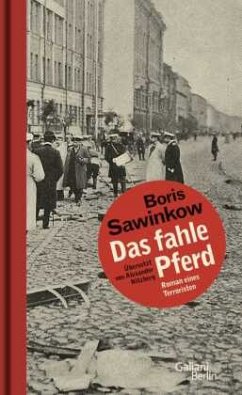Nicht lieferbar

Das Puschkinhaus
Roman
Übersetzung: Tietze, Rosemarie
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Leningrad, November 1961. Am Morgen nach den Revolutionsfeierlichkeiten tobt der Wind durch die ausgestorbene Stadt, reißt das Fenster eines kleinen Palais auf und entdeckt den Philologen Ljowa Odojewzew tot am Boden seines verwüsteten Arbeitszimmers liegend, eine Duellpistole Puschkins in der Hand.Mit dieser Szene beginnt Andrej Bitows legendärer Roman, der neben Nabokovs Gabe, Bulgakows Meister und Margarita und Jerofejews Moskva - Petuski zu den prägenden Büchern einer neuen Autorengeneration in Rußland gehörte. Ljowa, Sproß eines Adelsgeschlechts, ein indifferenter "Held unserer Ze...
Leningrad, November 1961. Am Morgen nach den Revolutionsfeierlichkeiten tobt der Wind durch die ausgestorbene Stadt, reißt das Fenster eines kleinen Palais auf und entdeckt den Philologen Ljowa Odojewzew tot am Boden seines verwüsteten Arbeitszimmers liegend, eine Duellpistole Puschkins in der Hand.
Mit dieser Szene beginnt Andrej Bitows legendärer Roman, der neben Nabokovs Gabe, Bulgakows Meister und Margarita und Jerofejews Moskva - Petuski zu den prägenden Büchern einer neuen Autorengeneration in Rußland gehörte. Ljowa, Sproß eines Adelsgeschlechts, ein indifferenter "Held unserer Zeit", zwischen verschiedenen Frauen hin- und hergerissen, hat sich in der Gelehrtenexistenz eingerichtet. Erschüttert von der Begegnung mit dem Großvater, der dreißig Jahre in Arbeitslagern zugebracht hat, wählt Ljowa dennoch den Weg seines Vaters. "Väter und Söhne" verbindet die Einsicht, daß Flucht, Untreue und Verrat lebensnotwendig sind...
Mit dieser Szene beginnt Andrej Bitows legendärer Roman, der neben Nabokovs Gabe, Bulgakows Meister und Margarita und Jerofejews Moskva - Petuski zu den prägenden Büchern einer neuen Autorengeneration in Rußland gehörte. Ljowa, Sproß eines Adelsgeschlechts, ein indifferenter "Held unserer Zeit", zwischen verschiedenen Frauen hin- und hergerissen, hat sich in der Gelehrtenexistenz eingerichtet. Erschüttert von der Begegnung mit dem Großvater, der dreißig Jahre in Arbeitslagern zugebracht hat, wählt Ljowa dennoch den Weg seines Vaters. "Väter und Söhne" verbindet die Einsicht, daß Flucht, Untreue und Verrat lebensnotwendig sind...