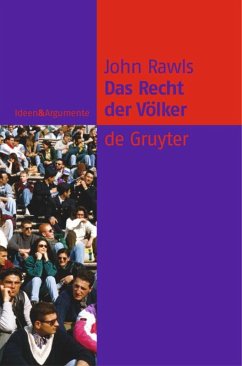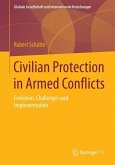Welche Bedingungen lassen Völker gerecht und friedlich zusammenleben? Unter welchen Umständen sind Kriege gerechtfertigt? Welche Leitlinien müssen gegeben sein für Organisationen, die eine gerechte Gesellschaft von Völkern mit gleichen Rechten herzustellen vermögen?
In acht Grundsätzen für eine gerechte internationale Ordnung entwickelt der amerikanische Philosoph John Rawls einen hypothetischen "Vertrag der Gesellschaft der Völker".
Das jüngste Buch von John Rawls ist nach A Theory of Justice 1971, dt. 1975) und Political Liberalism (1993, dt. 1998) ein weiteres wichtiges Werk des bedeutenden amerikanischen Philosophen. Die Originalausgabe (The Law of Peoples, 1999) hat zu heftigen Kontroversen geführt.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
In acht Grundsätzen für eine gerechte internationale Ordnung entwickelt der amerikanische Philosoph John Rawls einen hypothetischen "Vertrag der Gesellschaft der Völker".
Das jüngste Buch von John Rawls ist nach A Theory of Justice 1971, dt. 1975) und Political Liberalism (1993, dt. 1998) ein weiteres wichtiges Werk des bedeutenden amerikanischen Philosophen. Die Originalausgabe (The Law of Peoples, 1999) hat zu heftigen Kontroversen geführt.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Warum ein Krieg zum Ausbau der Weltmacht nicht zur Selbstverteidigung gehört: John Rawls' Oxforder Vorlesung zum Völkerrecht
Seit langem ist das Völkerrecht beziehungsweise Internationale Recht eine Domäne der Juristen. Seine moderne Form, im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert entstanden, wird aber zunächst von philosophisch gebildeten Moraltheologen entwickelt, von den Spaniern Bartolomé de Las Casas über Francisco de Vitoria bis Francisco Suárez. Obwohl es mit und seit Hugo Grotius in die Kompetenz der Juristen wandert, bleibt es wegen naturrechtlicher Komponenten im Einflußbereich von Philosophen, beispielsweise von Christian Wolff und - mit seiner Friedenstheorie - von Immanuel Kant. In dieser Tradition eines philosophischen Völkerrechts steht die zu einem Buch überarbeitete Oxforder Amnesty-Vorlesung von John Rawls.
Als Philosoph leistet Rawls "natürlich" keinen Beitrag zum positiven Völkerrecht, wohl aber zu dessen rechtsmoralischer Begründung und Ausgestaltung. Auf die Kernfrage, unter welchen Bedingungen das Zusammenleben von Völkern friedlich und gerecht ist, einschließlich der aktuellen Frage, unter welchen Umständen Kriege gerechtfertigt sind, antwortet er mit einer "realistischen Utopie", bestehend aus acht Grundsätzen, die bewußt nicht neu, sondern allvertraut sind. Die Liste beginnt mit der Freiheit und Unabhängigkeit der Völker und der Pflicht, Verträge zu erfüllen, und reicht über das Recht, an bindenden Übereinkünften beteiligt zu sein, die Pflicht der Nichteinmischung, das Recht auf Selbstverteidigung, aber keines anderen Rechts, Kriege zu führen, bis zur Pflicht, die Menschenrechte zu achten und anzuerkennen, Kriege unter Beachtung bestimmter Einschränkungen zu führen, und der Pflicht, Völkern zu helfen, die unter ungünstigen Bedingungen leben, welche eine gerechte oder achtbare politische und soziale Ordnung verhindern.
Mit dem zunächst erstaunlichen Ausdruck "Völker" (peoples) entscheidet sich Rawls gegen die im Englischen üblichen Bezeichnungen "nations" oder "states". Denn damit verbänden sich zwei Souveränitätsbefugnisse, die einer liberalen Gerechtigkeitskonzeption widersprächen: das Recht, als Mittel staatlicher Politik Krieg zu führen, und die Autonomie hinsichtlich der Art, wie man das eigene Volk behandelt.
Weil das Recht der Völker je nach deren politischer Grundstruktur unterschiedlich ausfallen könnte, beginnt Rawls mit einer klärenden Unterscheidung, der Aufzählung von fünf Arten heimischer Gesellschaften. Die vernünftigen liberalen und die nichtliberalen, aber wegen ihrer Konsultationshierarchie achtbaren Völker bilden zusammen die wohlgeordneten Völker. Ihnen stehen Staaten gegenüber, die sich einem vernünftigen Recht der Völker verweigern, also "Schurkenstaaten". Die Übersetzung ist jedoch mißverständlich, da das Original nicht den berühmten umgangssprachlichen Ausdruck "rogue states" verwendet, sondern stärker fachsprachlich von "outlaw regimes", von zu ächtenden Regimen, spricht. Neben den durch ungünstige Umstände belasteten Gesellschaften stehen jene wohlwollenden absolutistischen Gesellschaften, in denen die Menschenrechte geachtet werden, den Mitgliedern aber eine Rolle bei der Entscheidungsfindung verweigert wird.
Auf der Grundlage dieser Unterscheidung weitet Rawls in drei Schritten seine berühmte Vertragstheorie auf das Zusammenleben von Völkern aus. Statt natürlicher Personen sind es jetzt Völker, die in einem hypothetischen Gesellschaftsvertrag die Grundsätze ihrer künftigen Beziehungen festlegen: Der "erste Teil der Idealtheorie" geht von liberalen demokratischen Völkern aus und nimmt plausiblerweise als deren Grundinteressen an: die politische Unabhängigkeit, den Schutz der eigenen politischen Kultur, die territoriale Integrität, den Wohlstand der Bürger und die angemessene Selbstachtung. Der "zweite Teil der Idealtheorie" weitet die Vertragstheorie auf achtbare Völker aus. Rawls will aber nicht etwa anderen Völkern liberale Gerechtigkeitsgrundsätze vorschreiben, obwohl es nicht falsch wäre, sie ihnen zu empfehlen. Denn den Grundsätzen liegen nicht etwa westliche, sondern allgemein menschliche Interessen und Werte zugrunde. Für ein Völkerrecht ist freilich Rawls' Bescheidenheit sachgerecht, vor allem jene Toleranz, die auch nichtliberale Völker als gleichberechtigte Mitglieder einer Gesellschaft anerkennt. Wegen dieser "völkerrechtlichen Toleranz" vergewissern sich liberale Gesellschaften, daß ihre Grundsätze der Außenpolitik auch vom Standpunkt achtbarer Staaten aus vernünftig sind.
Zum Irak-Krieg kann Rawls nicht mehr Stellung nehmen, da er vor einigen Monaten verstorben ist und vorher schwer krank war. Einige seiner im dritten Teil, der "Nichtidealen Theorie", ausgeführten Gesichtspunkte geben aber Anhaltspunkte. Gegen einen selbstvergessenen Pazifismus betont Rawls ein Recht auf Krieg - als Selbstverteidigung im Fall liberaler Gesellschaften "zur Verteidigung liberaler demokratischer Institutionen und der vielen religiösen und nichtreligiösen Traditionen und Lebensformen der bürgerlichen Gesellschaft". Ob Rawls die neue Kriegsart, den präventiven Krieg, darunter subsumieren würde, ist nicht ausgemacht. Jedenfalls gehört nicht zur Selbstverteidigung - so Rawls mit Nachdruck - ein Krieg für ökonomischen Wohlstand oder für die Erringung natürlicher Ressourcen und schon gar nicht für den Ausbau der (Welt-)Macht. Denn dann achtet man nicht länger das Recht der Völker, sondern wird selbst zu einem "outlaw regime": zu einem Staat, der wegen einer Mißachtung entsprechender Rechte internationale Ächtung verdient.
Rawls verlangt zwischen der Führungselite und der Zivilbevölkerung eines "Schurkenstaates" zu unterscheiden. Denn letztere, oft in Unwissenheit gehalten und von der staatlichen Propaganda mitgerissen, sei nicht verantwortlich. Und der Philosoph, der im Zweiten Weltkrieg selber im Pazifik als amerikanischer Soldat diente, spricht aus, was der rechtsmoralische Common sense schon lange wußte: Weil sich die Brandbomben auf Tokio und die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki gegen die Zivilbevölkerung richteten, waren sie schwere Vergehen (im Englischen "very grave wrongs": sehr gravierendes Unrecht). Die Bombardierung deutscher Städte seitens Großbritanniens wiederum könnte als Ausnahme einer äußersten Notlage vielleicht gerechtfertigt gewesen sein, allerdings nur so lange, wie Deutschland militärisch klar überlegen erschien, also bis zum Herbst 1941. Eventuell könnte man den Zeitraum sogar bis Stalingrad ausdehnen, weiter aber, namentlich bis zur Bombardierung von Dresden, klarerweise nicht.
Aus zwei Gründen sind nach Rawls in der Art der Kriegführung die Menschenrechte der anderen Seite, sowohl der Zivilisten als auch der Soldaten, zu achten: weil das Recht der Völker es gebiete und weil man auf diese Weise den Inhalt und die Bedeutung der Menschenrechte am besten vermittle. Nicht zuletzt sagt er in aller Klarheit einer wohlüberlegten politischen Ethik: "Die wohlfeile Berufung auf Zweck-Mittel-Erwägungen rechtfertigt zu schnell zu viel und bietet den dominierenden Kräften in einer Regierung eine Möglichkeit, etwaige störende moralische Skrupel zum Schweigen zu bringen."
OTFRIED HÖFFE
John Rawls: "Das Recht der Völker". Aus dem Amerikanischen von Wilfried Hinsch. Walter de Gruyter Verlag, Berlin 2002. 285 S., br., 24,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
In seinem Werk "Das Recht der Völker" sucht der kürzlich verstorbene Moralphilosoph John Rawls eine Antwort auf die Frage, wann ein Krieg geführt werden darf, berichtet Rezensent Detlef Horster. Wie Horster ausführt, ist für Rawls die Beseitigung der Ungerechtigkeit innerhalb eines Volkes die Voraussetzung dafür, dass die Ungerechtigkeit zwischen den Völkern verschwindet. Solange es allerdings Schurkenstaaten gebe, würden einige Atomwaffen und konventionelle Bomben benötigt, um diese Staaten in Schach zu halten. Freilich, so Horster, bleibe es für Rawls die große moralische und gegenwärtig aktuelle Frage, wann sie eingesetzt werden dürfen. Die Erörterung dieser Frage bildet laut Horster das Zentrum des Bandes. Der Abwurf einer Atombombe als Angriff auf die Zivilbevölkerung ist für Ralwls nur im äußersten Notfall gerechtfertigt, wenn etwa "für die ganze Welt beim Sieg des Gegners ein dunkles Zeitalter" bevorstünde, oder wenn das Überleben des eigenen Volkes gefährdet sei, betont Horster. Diese äußerste Notlage war nach Ansicht Rawls im Juni/Juli 1945 für die Amerikaner nicht gegeben. Rawls plädiert für einen Friedensvertrag zwischen den Völkern, bei dem die einzelnen Völker ihren Status in der Weltgemeinschaft nicht ins Kalkül ziehen dürften, sondern von absoluter Gleichberechtigung ausgehen müssten. "Hat er", fragt Horster abschließend, "den derzeitigen Hegemonieanspruch der Vereinigten Staaten vergessen?"
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Nun ist »Das Recht der Völker« [...] in einer ambitionierten neuen Reihe beim Berliner Verlag de Gruyter erschienen. [...], dass aus »Das Recht der Völker« - wie immer bei Rawls - viel gelernt werden kann [...]."
Neue Zürcher Zeitung
"Gegen Ende seines Lebens gab John Rawls Antwort auf die Frage, wann ein Krieg geführt werden darf".
Süddeutsche Zeitung
"»Das Recht der Völker« ist das am meisten beschäftigende und zugänglichste Buch von Rawls."
Times Literary Supplement
"Es ist sein persönlichstes Buch geworden - eines, das den politischen Menschen John Rawls zeigt, der in diesem Buch auch die Erfahrungen seines Jahrhunderts zu verarbeiten sucht."
Frankfurter Rundschau
"Die Originalausgabe »The Law of Peoples«, veröffentlicht 1999, wurde von der Kritik als das "zugänglichste Buch von Rawls" gewürdigt; nun ist die fachkundige deutsche Übersetzung des Philosophen Wilfried Hinsch in einem Land erschienen, das nicht Krieg führen will. Nicht diesen gegen den Irak."
Die Zeit
Neue Zürcher Zeitung
"Gegen Ende seines Lebens gab John Rawls Antwort auf die Frage, wann ein Krieg geführt werden darf".
Süddeutsche Zeitung
"»Das Recht der Völker« ist das am meisten beschäftigende und zugänglichste Buch von Rawls."
Times Literary Supplement
"Es ist sein persönlichstes Buch geworden - eines, das den politischen Menschen John Rawls zeigt, der in diesem Buch auch die Erfahrungen seines Jahrhunderts zu verarbeiten sucht."
Frankfurter Rundschau
"Die Originalausgabe »The Law of Peoples«, veröffentlicht 1999, wurde von der Kritik als das "zugänglichste Buch von Rawls" gewürdigt; nun ist die fachkundige deutsche Übersetzung des Philosophen Wilfried Hinsch in einem Land erschienen, das nicht Krieg führen will. Nicht diesen gegen den Irak."
Die Zeit