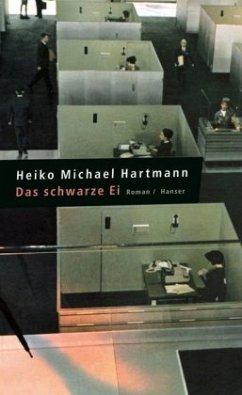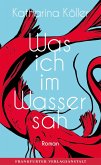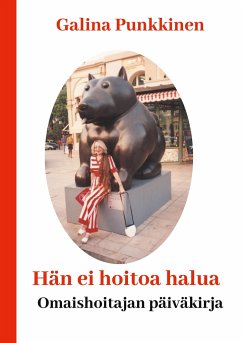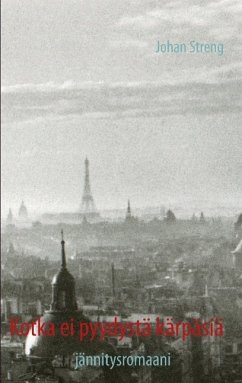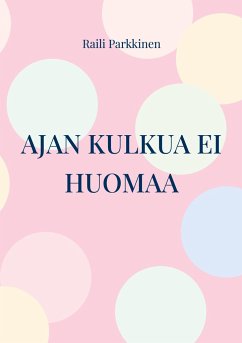Ein arbeitsloser Akademiker hat Glück: Mit einem aufpolierten Lebenslauf und gefälschten Zeugnissen bekommt er in Berlin einen tollen Job in der Bundesgeschäftsstelle einer Partei. Doch die Sache hat einen Haken: Ständig muss er damit rechnen, als Betrüger entlarvt zu werden. Die karrieregeilen, rücksichtslosen Kollegen sitzen ihm im Nacken und seine Panik steigt von Tag zu Tag. Der Traum wird zum Alptraum. Bis plötzlich eine Ministerin auf ihn aufmerksam wird und an ihm Gefallen findet. Eine schonungslose Spiegelung des deutschen Alltagsmilieus.

Heiko Michael Hartmann ist der einzig wahre Hauptstadtdichter
An Regentagen im Winter ist der Berliner Tiergarten eine graubraune, mit spärlichem Grün durchsetzte nasse Masse, weder Landschaft noch Stadt. Wir laufen, der Autor voran, hinter den Denkmälern der Kriegsherren Moltke und Roon über lehmige Wege durch struppiges Gebüsch, unter kahlen Eichen und Buchen, bis wir an einen schmiedeeisernen Zaun kommen. Dahinter liegt, von der Straße aus kaum sichtbar, ein graphitfarbener Bau, der vage an die Raumschiffe in "Independence Day" erinnert. "Das", sagt Heiko Michael Hartmann, "ist das schwarze Ei."
Das schwarze Ei ist das Berliner Bundespräsidialamt. Hier arbeiten, geschützt durch Quader aus poliertem Naturstein und Sicherheitsglasfenster, 150 Angestellte des Bundespräsidenten, der nebenan im Schloss Bellevue residiert. Im Inneren umrahmen gipsweiße Säulengänge einen Lichthof mit Kassettendecke. Die Büroräume, gleichfalls weiß wie Schnee, sind streng geometrisch abgeteilt; wer die Wände mit Postern, Kalendern oder anderen persönlichen Gegenständen verunziert, bekommt es mit dem Chef zu tun. Heiko Michael Hartmann weiß das genau, denn er hat das schwarze Ei ausführlich studiert, die Flure, die Kantine, die Büros. Warum? Weil er Schriftsteller ist. Hauptstadtschriftsteller, um genau zu sein. Wenn man es ganz genau nimmt, ist Hartmann zurzeit sogar der einzige richtige Hauptstadtschriftsteller überhaupt.
Heiko Michael Hartmann hat einen Roman geschrieben: "Das schwarze Ei". Es ist sein dritter. Für seinen ersten, "MOI", bekam er 1996 einen Preis in Klagenfurt. Sein zweites Buch "Unterm Bett", eine Satire auf das Liebes- und Arbeitsleben deutscher Beamter, war fast ein wenig zu klug für seinen Gegenstand. Mit dem "Schwarzen Ei" müsste Hartmann nun mindestens zum Lieblingsschriftsteller der Beamtenkaste Berlins aufsteigen. Denn der Roman schildert das, was die Insassen der neuen deutschen Betonklötze im Spreebogen und der Ministerienkästen in Mitte aus täglicher Anschauung kennen: Gänge. Vorgänge. Abteilungsleiter. Ablagen. Büroklatsch. Schmutzkampagnen. Parteistrategen. Redenschreiber. Berufsmaulhelden. Er beschreibt, kurz gesagt, die politische Innenwelt der Hauptstadt. Und er tut das mit so viel Witz und Verstand, dass man den Roman auch als eine Hommage lesen kann: an den Staat, der solche Geschichten hervorbringt. Und an die Bürokratie, die solche Figuren duldet.
Büroneurotiker
"Natürlich ist das Bundespräsidialamt nicht mein einziges Vorbild für die Geschichte." Wir gehen am Spreeufer entlang zum Kanzleramt, und Hartmann erzählt, dass er auch die Parteizentralen von SPD und CDU besichtigt habe, um Anschauungsmaterial für sein Buch zu bekommen. Der Blick auf die skandinavische Botschaft, den man vom CDU-Hauptquartier im westlichen Tiergarten aus genießt, hat ihm die Idee für eine der makabersten Szenen des Romans eingegeben: Der Held, ein Angestellter in der Zentrale einer fiktiven mitregierenden Kleinpartei, sieht vom Fenster aus, wie auf dem Balkon einer gegenüberliegenden afrikanischen Botschaft ein Mensch mit Stangen zu Tode geknüppelt wird. Aber kann er beschwören, was er sah? Als er einen Augenblick später wieder hinschaut, ist der Balkon leer. Bevor unser Mann überhaupt begriffen hat, was passiert ist, werden vor seinen Augen die Rollläden des Gebäudes heruntergelassen. Und wieder herrscht Ruhe im schwarzen Ei.
Etwas von der Irrealität, der Traumhaftigkeit dieser Szene hat auch der ganze Roman. Es beginnt damit, dass ein arbeitsloser Historiker, Autor einer Studie über byzantinische Einflüsse am Hof der Karolinger und Ottonen, zu einem Vorstellungsgespräch nach Berlin geladen wird. In der Presseabteilung irgendeines Parteiapparats ist eine Stelle frei. Der Mann hat keine Chance, sie zu bekommen. Aber dann stellt sich heraus, dass die zuständige Sekretärin Schicksal gespielt und die Bewerbungsunterlagen vertauscht hat. Mit falschem Lebenslauf und falschem Foto schlüpft unser Mann, der bis zum Ende der Geschichte namenlos bleibt, unter die Fittiche der Macht - ins schwarze Ei. In Hartmanns Buch ist es nur ein Anbau am fiktiven Parteihauptquartier. Im Übrigen aber sieht es genauso aus wie sein reales Vorbild, innen weiß, außen schwarz. So wie auch der Roman zugleich wohlsortiert und chaotisch ist, ein Wechselbalg aus Ordnung und Subversion.
Subversiv klingen schon die Namen der Beteiligten, der Insassen des schwarzen Eis: Mack, Schill, Glöckner, Toledo, Carassa. Eine Mischung aus Kabarett- und Agententhrillerpersonal. Eine Ministerin, die für die Kleinpartei am Kabinettstisch sitzt, wird "Kirschenmadonna" genannt, weil sie sich für ein Herrenmagazin leichtbekleidet unter einem Kirschbaum ablichten ließ. Mack, der direkte Kollege des Helden, hat sich ein "Existenzdiagramm" gebastelt, eine Art Wandtabelle, auf der er das Auf und Ab seines Lebens notiert. Die unheimlichste Figur in der Riege aber ist jener Ändi, den sich die Partei als Mann für grobe und gröbste Aufgaben hält. Ändi, der zum Spaß mit Schrotkugeln nach seinen Besuchern spuckt, schleust Computerviren in die Netzwerke gegnerischer Parteien ein. Sein fiesester Trick aber besteht darin, Politiker der anderen Seite vor wichtigen Auftritten anzurufen und ihnen mitzuteilen, ihr Kind sei bei einem Unfall ums Leben gekommen. "Tot! Ja, er! Zerquetscht, sein Kopf, ja, heute morgen. Ihr Sohn! Malin! Er hat die Vorfahrt nicht beachtet." Dass Malin ein Mädchenname ist, geht Ändi zu spät auf. Der Mann ist, was er auslöst - eine einzige Panne.
Bei Ändi, sagt Hartmann, habe er von weitem an Joschka Fischer gedacht. "Das ist ja auch einer, der Randale gemacht und sich dann zivilisiert hat." Der Telefonterror dagegen sei eine Erfindung der Surrealisten. "Die haben das tatsächlich gemacht mit Leuten, die sie nicht mochten." Und ein Verlierertyp wie Mack, der Büroneurotiker? "Wenn Sie mal längere Zeit in einer Behörde arbeiten, kommen Sie auf so was relativ leicht."
Hartmann hat in einer Behörde gearbeitet. Genau genommen arbeitet er immer noch dort, obgleich er für drei Jahre vom Dienst freigestellt wurde. Seit 1989 ist Heiko Michael Hartmann Verwaltungsjurist beim Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, das inzwischen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht heißt, kurz BaFin. Die Stelle, sagt Hartmann, habe er übers Arbeitsamt vermittelt bekommen. Seine erste größere Aufgabe bestand darin, eine Broschüre über das deutsche Bankwesen zu verfassen: "Da man wusste, dass ich gern schreibe, hat man mich gefragt." Die Broschüre war ein voller Erfolg, Hartmann bekam sogar ein Dankschreiben vom damaligen Finanzminister Theo Waigel. Von da an ging es aufwärts, im Amt und außerhalb. Selbst die grotesken Überzeichnungen des Beamtenalltags in "Unterm Bett" trugen ihm keinen Ärger ein. Im Gegenteil: "Der Roman ist heute so eine Art Kultbuch im Amt. Zu Geburtstagen und Betriebsjubiläen wird er gern verschenkt." Heiko Michael Hartmann, der Sänger des deutschen Dienstwegs.
Zu den Absurditäten rings um die Kür der neuen Hauptstadt gehörte es, dass Hartmanns Behörde im Jahr 2000 von Berlin nach Bonn umziehen musste. Der Schriftsteller aber ging nicht mit: "Es war von Anfang an klar, dass ich das nur als Brotberuf mache, damit ich die Freiheit zum Schreiben habe." Fünf Jahre lang arbeitete er am heimischen Bildschirm in Berlin für die Finanzaufsicht, dann ließ er sich freistellen. Seither lebt er von Erspartem und dem Einkommen seiner Frau. Vom deutschen Literaturbetrieb will er sich nicht vereinnahmen lassen. Dort, sagt Hartmann, lebe man weniger von den Büchern als vom Drumherum - Preisen, Stipendien, Auftragsarbeiten. Der Schriftsteller Hartmann aber will sich nicht vom Schreiben ablenken lassen. Zur Not bleibt ihm immer das Amt.
Beamtenromantiker
Heiko Michael Hartmann wirkt so, als könnte ihn keine literarische Mode, kein Hauch aus den Feuilletons von seinem Kurs abbringen, und diese Sicherheit strahlt auch sein Buch aus. Das Durcheinander von innerem und äußerem Erlebnis in seinem Helden hat Hartmann in abgehackte, wie unter hohem Druck zersplitterte Sätze gefasst, die wie Einstellungen einer Handkamera wirken, schnell, spontan, unscharf und wieder scharf, angerissene Bilder einer Wirklichkeit, die nur in solchen Fragmenten sichtbar wird. In ihrem Taumel spiegelt sich das Lächerliche des politischen Alltags, wie in der Schilderung einer Werbeaktion im offenen Cabrio: "Die Augen, der Nacken von der Anstrengung steif, sprangen rechts und links drehten sich Passanten, die, so schnell fuhren sie, jetzt, die Fahne erkennend, an ihnen vorbeiflogen. Aufschwung, seitlich, vorne, hinten klebte es auf dem Lack, für Deutschland."
Für Deutschland? "Dieses System", sagt Hartmann, als wir, vom Kanzleramt kommend, auf das Paul-Löbe-Haus mit den Abgeordnetenbüros zugehen, "ist das beste, das die Menschen in Jahrhunderten hervorgebracht haben." Nur sähen das die Leute nicht mehr. Die Vergeudung von Talent, von Enthusiasmus und Lebenskraft in diesem Land sei ungeheuer. Aber in die allgemeine Hetze gegen die Beamten will Hartmann, Sohn eines Bundeswehr-Juristen, nicht einstimmen. "Deutschsein und Beamtentum hängen eng zusammen." Auch Eichendorff und E. T. A. Hoffmann waren schließlich Staatsdiener, und wer weiß, was aus der Dichtung der Romantik ohne das preußische Beamtenwesen geworden wäre.
"Im Amt gab es viele wie mich, Musiker, Maler, Dichter." Inzwischen haben die meisten Karriere gemacht und auf die Kunst verzichtet. Heiko Michael Hartmann ist dabeigeblieben, ohne sein Behördendasein ganz aufzugeben. Vielleicht kann er deshalb Dinge sehen und beschreiben, zu denen die meisten anderen deutschen Schriftsteller keinen Zugang haben. Es gibt Bücher über das Studentenleben in Friedrichshain, das Arbeitslosenleben in Kreuzberg, das Singledasein am Prenzlauer Berg, aber für das, was die Hauptstadt zur Hauptstadt macht, das Leben der politischen Klasse, bleiben die Spiegel der zeitgenössischen Literatur blind. Mit einer Ausnahme. Sie heißt Heiko Michael Hartmann. Möge ihn das Amt noch lange freistellen - und ihm den Ruf nach Bonn ersparen.
ANDREAS KILB
Heiko Michael Hartmann: "Das schwarze Ei". Roman. Hanser, 240 Seiten, 19,90 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Als "amüsante Politsatire" über einen Berliner Verwaltungsjuristen, der dank einer Sekretärinnenintrige unverdient einen Spitzenjob bekommt, beschreibt Rezensent Hans-Peter Kunisch diesen Roman. Eine Weile fiebert er planmäßig mit dem Protagonisten mit, der ständig Angst hat, aufzufliegen. Als sich diese Spannung ein wenig abgeschliffen hat, stösst ihm dann doch die etwas gekünstelte, an Arno Schmitt und dem "Rönne-Stil" orientierte Sprache auf, in welcher der Roman geschrieben ist. Zwar ist diese "zersetzte Sprache" aus Sicht des Rezensenten eine der Stärken des Romans. Inhaltlich aber finde diese sprachliche Ambition keine Entsprechung. Denn es fehlt Heiko Michael Hartmanns Roman, wenn man Kunisch richtig versteht, eine Spur mehr Mut zur "schwarzen Groteske", weshalb sein drittes Buch für den Rezensenten letztlich nur eine "freundlich-skurrile" Geschichte bleibt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Nach der Lektüre riecht's schön frisch nach Reinigungsmittel in den endlosen Fluren der grauen Zellen, und durchs Oberstübchen weht eine leise Ahnung, wie wirklich moderne Literatur aussehen kann." Stern, 05.10.06
Hartmann ist zurzeit "der einzige richtige Hauptstadtschriftsteller überhaupt." (...) Er beschreibt, (...) die politische Innenwelt der Hauptstadt. Und er tut das mit so viel Witz und Verstand, dass man den Roman auch als eine Hommage lesen kann: an den Staat, der solche Geschichten hervorbringt. Und an die Bürokratie, die solche Figuren duldet." Andreas Kilb, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 14.01.07
Hartmann ist zurzeit "der einzige richtige Hauptstadtschriftsteller überhaupt." (...) Er beschreibt, (...) die politische Innenwelt der Hauptstadt. Und er tut das mit so viel Witz und Verstand, dass man den Roman auch als eine Hommage lesen kann: an den Staat, der solche Geschichten hervorbringt. Und an die Bürokratie, die solche Figuren duldet." Andreas Kilb, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 14.01.07