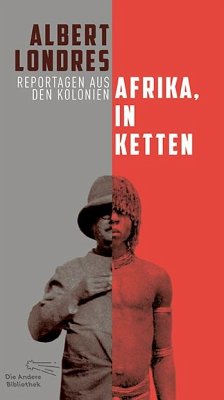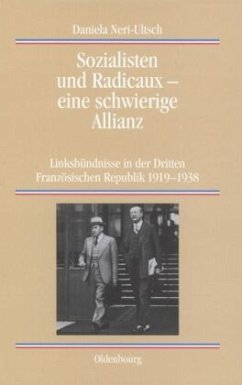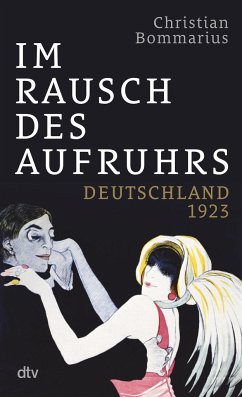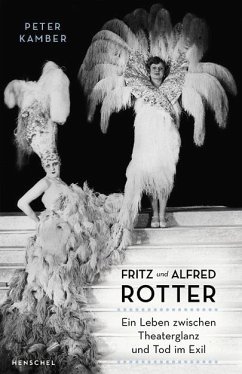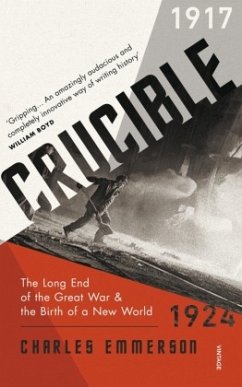Das schwierige Spiel des Parlamentarismus
Deutscher Reichstag und französische Chambre des Députés in den Inflationskrisen der 1920er Jahre

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Das Scheitern der Weimarer Republik ist eng mit den Problemen und Schwächen verbunden, die das erste große Experiment eines parlamentarischen Regierungssystems in Deutschland aufwies. Doch auch in anderen europäischen Staaten zeigten sich zwischen den Weltkriegen schwerwiegende parlamentarische Krisen. Thomas Raithel vergleicht erstmals systematisch den Parlamentarismus der Weimarer Republik mit jenem der späten Dritten Republik Frankreichs und rückt dabei besonders die beiden nationalen Inflationskrisen der 1920er Jahre in den Mittelpunkt. Während der deutschen Hyperinflation geriet das...
Das Scheitern der Weimarer Republik ist eng mit den Problemen und Schwächen verbunden, die das erste große Experiment eines parlamentarischen Regierungssystems in Deutschland aufwies. Doch auch in anderen europäischen Staaten zeigten sich zwischen den Weltkriegen schwerwiegende parlamentarische Krisen. Thomas Raithel vergleicht erstmals systematisch den Parlamentarismus der Weimarer Republik mit jenem der späten Dritten Republik Frankreichs und rückt dabei besonders die beiden nationalen Inflationskrisen der 1920er Jahre in den Mittelpunkt. Während der deutschen Hyperinflation geriet das parlamentarische System in eine ernsthafte Krise und Regierung und Reichspräsident konnten ihr Verordnungsregime ausbauen. Hingegen überstand der französische Parlamentarismus "seine" Inflationskrise weit besser. Ausgehend von einer Beschreibung der parlamentarischen Prozesse analysiert der Autor die jeweiligen Krisen- bzw. Stabilitätsfaktoren. In dem modernen, auf Parteien gestützten System der Weimarer Republik steht das Scheitern einer konsensorientierten Koalitionspolitik im Mittelpunkt. Auf französischer Seite sind vor allem die Funktionsweisen des traditionellen deliberativen Parlamentarismus zu betrachten, die sich trotz offensichtlicher Schwächen noch immer als tragfähig erwiesen.